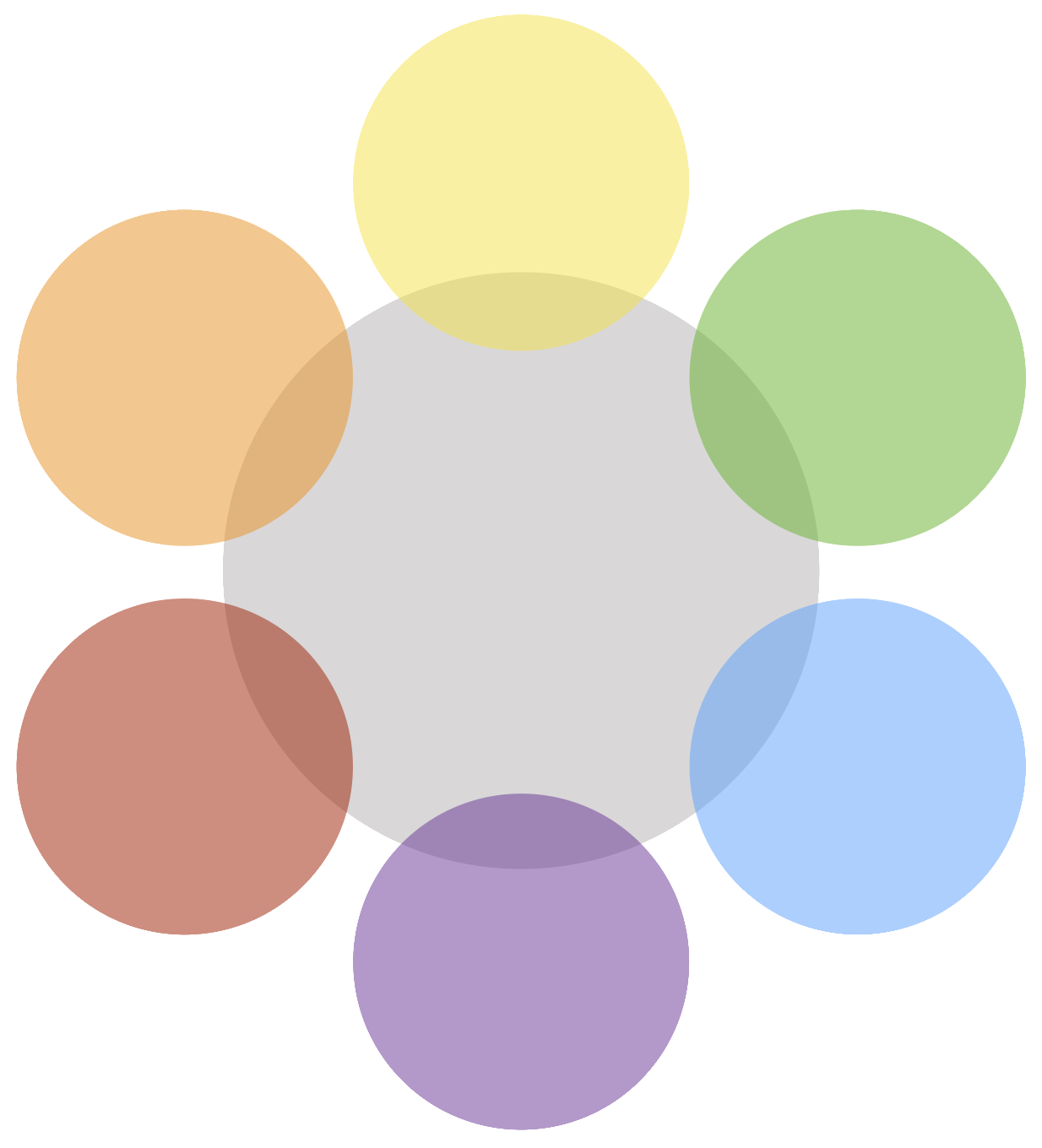 Geert Hofstede war ein niederländischer Kulturwissenschaftler, Sozialpsychologe und emeritierter Professor für Organisationsanthropologie sowie Internationales Management an der Universität Maastricht. In der Fachwelt gilt er als Begründer der statistisch fundierten interkulturellen Forschung.
Geert Hofstede war ein niederländischer Kulturwissenschaftler, Sozialpsychologe und emeritierter Professor für Organisationsanthropologie sowie Internationales Management an der Universität Maastricht. In der Fachwelt gilt er als Begründer der statistisch fundierten interkulturellen Forschung.
Messbare Aspekte
Ende der 1960er Jahre führte Hofstede eine empirische Studie mit mehr als 110.000 IBM-Mitarbeitern/innen in 67 Ländern durch und entwickelte daraus das Modell der Kulturdimensionen. Zunächst identifizierte Hofstede vier Kulturdimensionen, später folgten zwei weitere und auch die Anzahl der untersuchten Länder wurden auf 76 erhöht. „Eine Dimension ist ein Aspekt einer Kultur, der sich im Verhältnis zu anderen Kulturen messen lässt.“ (Hofstede 2017, 38)
Es folgen die Kulturdimensionen im Überblick:
-
Machtdistanz
Die Kulturdimension Machtdistanz beschreibt die Ausprägung der Machtverhältnisse innerhalb von Kulturen sowie deren Verteilung. Ob die Distanz zwischen Eltern und Kindern, Lehrenden und Lernenden, Vorgesetztem und Mitarbeiter – hierarchische Beziehungen können unterschiedlich toleriert werden. Machtdistanz ist somit der
„Grad, bis zu dem die weniger mächtigen Mitglieder von Institutionen und Organisationen in einem Land die ungleiche Verteilung der Macht erwarten und akzeptieren.“ (Hofstede 2017, 518)
-
Individualismus/ Kollektivismus*
Die zweite Kulturdimension beschreibt das Verhältnis von Individualismus und Kollektivismus innerhalb der jeweiligen Kultur. Während in individualistischen Kulturen die persönliche Selbstverwirklichung in den Vordergrund tritt, betonen kollektivistische Kulturen die Wir-Gruppen-Identität.
„Individualismus repräsentiert eine Gesellschaftsform, in der die sozialen Bindungen zwischen Individuen nicht sehr fest sind. Von jedem wird erwartet, dass er sich nur um sich selbst oder seine eigene, unmittelbare Familie kümmert.“ (Hofstede 2017, 516)
„Kollektivismus repräsentiert eine Gesellschaft, in der die Menschen von Geburt an in Wir-Gruppen leben, d. h. in Gruppen mit einem starken Zusammengehörigkeitsgefühl, die ihnen das ganze Leben lang Schutz für ihre außer Frage stehende Loyalität gewähren.“ (Hofstede 2017, 516)
-
Unsicherheitsvermeidung
Kulturen gehen auf unterschiedliche Art und Weise mit unbekannten Situationen, die Unsicherheit auslösen, um. Mitglieder von Gesellschaften mit einem hohen Maß an Unsicherheitsvermeidung versuchen, Unbekanntes sowie Unsicheres mit Hilfe ordnungspolitischer Maßnahmen zu kontrollieren. Kulturen mit niedriger Unsicherheitsvermeidung legen hingegen weniger Wert auf Regelorientierung.
Unsicherheitsvermeidung bezeichnet den„Grad, bis zu dem sich die Angehörigen einer Kultur durch uneindeutige oder unbekannte Situationen bedroht fühlen.“ (Hofstede 2017, 522)
-
Maskulinität versus Femininität
Die Kulturdimension der Maskulinität und Feminität ist eine soziokulturelle Kategorie, da sie die Rollenverteilung zwischen Männern und Frauen beschreibt.
„Maskulinität steht für eine Gesellschaft, in der die emotionalen Geschlechterrollen klar festgelegt sind: Männer sollen durchsetzungsfähig und hart sein und sich auf materiellen Erfolg konzentrieren; Frauen sollen bescheiden und zärtlich sein und sich mit der Lebensqualität beschäftigen.“ (Hofstede 2017, 518)
„Femininität repräsentiert eine Gesellschaft, in der sich die emotionalen Geschlechterrollen überschneiden: sowohl Männer wie auch Frauen gelten als bescheiden, sensibel und um Lebensqualität bemüht.“ (Hofstede 2017, 514)
-
Langzeit- und Kurzzeitorientierung
Die Dimension der Langzeit- und Kurzzeitorientierung beschreibt die Ausrichtung von Gesellschaften auf entweder kurzfristige Erfolge oder auf langanhaltende Lösungen.
„Langzeitorientierung steht für das Hegen von Tugenden, die auf künftigen Erfolg hin ausgerichtet sind, insbesondere Sparsamkeit und Beharrlichkeit.“ (Hofstede 2017, 518)
„Kurzzeitorientierung steht für das Hegen von Werten, die auf die Vergangenheit und Gegenwart bezogen sind, insbesondere Respekt für Traditionen, Wahrung des ‚Gesichts‘ und Erfüllung sozialer Pflichten.“ (Hofstede 2017, 517)
-
Genuss und Zurückhaltung
Die sechste Kulturdimension aus dem Jahr 2010 beschreibt, wie in einer Gesellschaft mit der Auslebung individueller Bedürfnisse umgegangen wird – genussorientiert oder eher zurückhaltend.
„Genuss steht für eine Gesellschaft, in der eine relativ großzügige Befriedigung grundlegender und natürlicher Bedürfnisse des Menschen erlaubt ist, die darin bestehen, das Leben zu genießen und Spaß zu haben.“
„Zurückhaltung steht für eine Gesellschaft, in der die Befriedigung von Bedürfnissen unterdrückt und mit Hilfe strikter sozialer Normen geregelt wird.“
Kritische Stimmen
Kritiker Hofstedes bemängeln, dass die Umfragen ausschließlich unter IBM-Mitarbeitern/innen stattfanden und die Ergebnisse daher keine repräsentativen Rückschlüsse auf die gesamte Bevölkerung eines Landes zulassen würden. IBM-Mitarbeiter/innen entsprechen keinen ‚durchschnittlichen‘ Bürgern, da für diese Tätigkeit eine überdurchschnittlich hohe Qualifizierung nötig sei.
Auch der deutsche Kulturwissenschaftler Klaus P. Hansen kritisiert Hofstedes Theorie der Kulturdimensionen: „Alles in allem ist sein Buch für die moderne Kulturwissenschaft eine Katastrophe. Er versündigt sich an allen Fortschritten, die seit den sechziger Jahren erzielt wurden, und ausgerechnet dieses Machwerk hat die Unbelehrbaren, die den Kulturbegriff für Unfug hielten, belehrt. Jene Psychologen, Soziologen und Wirtschaftswissenschaftler, die nur empirischen Analysen trauen, wurden durch Hofstedes Statistik davon überzeugt, dass Kultur aus hard facts bestehe, die man messen und wiegen kann.“ (Hansen 2000, 285)
Weiterhin wird kritisiert, dass ein ganzes Land als Gruppe charakterisiert werde, die nicht die Identität und das Selbstverständnis einzelner sozialer Gruppen widerspiegeln könne. Da sich die Gesellschaft in einem ständigen Prozess und Wandel befindet, sind die inzwischen über 40 Jahre alten Daten aus heutiger Sicht nicht mehr aussagekräftig genug. Auch die lediglich sechs bisher beschriebenen Dimensionen genügen nicht, um komplexe Kulturen ausreichend zu definieren.
Hier geht es zum Überblick aller Lexikonartikel…
Literatur
Hansen, Klaus P. (2000): Kultur und Kulturwissenschaft. Eine Einführung. 2. Aufl. Tübingen/ Basel: Francke.
Hofstede, G.: Lokales Denken, globales Handeln. Interkulturelle Zusammenarbeit und globales Management. 6. Aufl. München: Beck.
Geert Hofstede: https://geerthofstede.com [07.07.2018].
*Eine wahre Begebenheit, die illustriert, was es bedeuten kann, wenn Individualismus und Kollektivismus sehr unterschiedlich ausgeprägt sind, wird in dem Buch von Benjamin Haag, geschildert:
Klo ohne Tür (Ungarn)
Es war das erste Treffen nach der ersten Nacht in den Häusern der ungarischen Gasteltern und die Austauschschüler der Ungarnfreizeit fanden kaum Worte für das, was sie am vergangenen Tag erlebt hatten. Doch es waren weder die Familien noch das Essen, worum sich ausnahmslos alle Gespräche drehten und selbst an das nächste Ausflugsziel verschwendete niemand auch nur einen Gedanken. Denn die deutschen Schüler sahen sich mit einem Problem konfrontiert, von dem sie nie geglaubt hätten, dass es jemals eines werden könnte: die Toilettenschlüssel.
„Meine Familie hat keinen Schlüssel zu ihrem Badezimmer.“, klagte Julia und schüttelte den Kopf. „Jeder läuft da rein und raus, wie es ihm passt, man kann nicht allein sein. Als ich fragte, wo der Schlüssel sei, meinten sie, es habe vielleicht nie einen gegeben.“ Cathy nickte, sie hatte die gleiche Erfahrung gemacht. „Ich musste erst lang und breit erklären, dass ich nicht will, dass jemand pinkeln geht, wenn ich gerade unter der Dusche bin. Und dann waren sie auch noch sauer.“ Verständnisvolles Nicken von allen Seiten, nur Arne verzog die Lippen zu einem schmalen Strich. „Ihr habt gut reden, meine Familie hat nicht mal eine Badezimmertür. Die haben da keine Tür. So gar keine. Einfach keine Tür.“
Die begleitende Lehrerin konnte die Aufregung nicht verstehen, was nicht verwunderlich war, da sie beschlossen hatte, sich der interessanten Erfahrung, die Nacht bei einer Gastfamilie zu verbringen, zu entziehen und stattdessen in einem Hotel zu nächtigen. Sie schlug vor, mit den Familien zu sprechen und sie zu bitten, noch einmal nach einem Schlüssel zu suchen. Für Arne hatte sie keinen Rat, wahrscheinlich war es sogar ihr zu albern, ihm vorzuschlagen, die Familie zu bitten, mal auf die Suche nach der Tür zu gehen. Sie wandte sich in einem Moment, in dem sie glaubte, vor unseren Ohren sicher zu sein, vertrauensvoll an den zweiten Begleiter: „Wenigstens haben wir das Glück, dass wir kein Mädchen in eine Wohnung ohne Tür gesteckt haben.“ Der Lehrer sah sie ausdruckslos an. Wahrscheinlich wusste er nicht, was er darauf noch antworten sollte.
Für uns Schüler war das Problem mit den Toilettentüren auch am Abend noch nicht geklärt und so folgten wir dem Rat, die Familien anzusprechen. Die Stimmung war damit erst einmal hin, es war, als wäre die Temperatur in ganz Ungarn mit einem Mal um zehn Grad gesunken. Am nächsten Morgen standen wir mit dementsprechend langen Gesichtern in einem Kreis zusammen und berichteten.
Julias Familie hatte nach wie vor keinen Badezimmerschlüssel, doch sie durfte ein „Besetzt“-Schild an die Tür hängen, das bislang auch beachtet wurde. Von ihrer Familie wurde es aber demonstrativ nicht benutzt, der Vater nannte es Deutsches Schild und klang dabei wenig wohlwollend. Bei Cathy tauchte wider Erwarten doch noch ein Schlüssel auf, die Großmutter hatte ihn in ihrem Nachtschränkchen, wo alle unbrauchbaren Dinge lägen, wie die Gastgebertochter es ausdrückte. Arnes Familie hatte immer noch keine Tür. Aus Gründen des Anstandes verzichteten wir darauf zu fragen, ob diese Tür denn theoretisch einen Schlüssel gehabt hätte. Und zumindest bei den anderen Austauschschülern hatte man sich mehr oder minder zufriedenstellend geeinigt. Unsere Begleiterin betonte erneut, was für ein Glück es war, dass es Arne getroffen habe. Diesmal hatte er sie gehört.
Als die ungarische Lehrerin, deren Tagesaufgabe unsere Führung durch die Schule zu sein schien, sich unserer Gruppe näherte, bekam sie mit, worüber wir uns unterhielten. Sie hob eine der dunklen Augenbrauen, schüttelte den Kopf, drückte ihre Hände zusammen und schüttelte erneut den Kopf. Da wir mittlerweile zu wissen glaubten, dass dies keine ungarische Art der Begrüßung war, sahen wir sie gespannt an.
Ob wir denn von allen guten Geistern verlassen seien, fragt sie sinngemäß. Das fanden wir schon ziemlich unfair, denn immerhin waren sie es doch, die ihre Toilettentüren nicht abschlossen. Die Badezimmer nicht zu verschließen sei ein Zeichen dafür, dass man vor seiner Familie nichts verheimlichen müsse, erklärte sie uns. Bei Fremden würde abgeschlossen, aber zu Hause sei dies verpönt. Es gebe nichts, was die Familie nicht wissen dürfe? Uns erschien dies so absurd, dass wir nicht sicher waren, ob sie das ernst meinte.
Irgendwie schien sie unser Verhalten aufzubringen. Ob wir nicht verstünden, dass es eine ganz große Geste sei, dass die Familien die Schlüssel nicht unseretwegen hervorgeholt hätten? Dass sie uns damit willkommen hießen und uns zu verstehen gaben, kein Fremder zu sein? Das bekamen wir tatsächlich nicht mit. Es war also eine Art Auszeichnung, dass wir keine Schlüssel bekommen hatten? So langsam ergab das Verhalten unserer Gastfamilien Sinn. Wir hätten doch nicht nach Schlüsseln gefragt? Betretendes Schweigen. Sie schloss die Augen eine gefühlte Minute lang, atmete aus und öffnete sie wieder. Dann musste sie den Gastfamilien wohl erklären, dass wir nicht ihre Gastfreundschaft zurückgewiesen hatten, sondern es einfach komisch fanden. Arne ließ seinen Kopf gegen die Wand sinken. „Meine Familie hat nicht mal eine Tür.“, nuschelte er. „Aber Hauptsache wir sind komisch…“
Transkript zum Erklärfilm:
Geert Hofstede entwickelte das Modell der sechs Kulturdimensionen. Die erste Kulturdimension ist die Machtdistanz. Dies meint die Verteilung der Machtverhältnisse innerhalb von Kulturen. Individualismus/ Kollektivismus. Während in individualistischen Kulturen die persönliche Selbstverwirklichung in den Vordergrund tritt, betonen kollektivistische Kulturen die Gruppen-Identität. Unsicherheitsvermeidung. Mitglieder von Gesellschaften mit einem hohen Maß an Unsicherheitsvermeidung versuchen, Unbekanntes zu kontrollieren. Kulturen mit niedriger Unsicherheitsvermeidung legen weniger Wert auf Regelorientierung. Maskulinität versus Femininität. Wie sind die Rollen zwischen Männern und Frauen verteilt? Langzeit- und Kurzzeitorientierung. Diese Dimension meint die Ausrichtung von Gesellschaften auf kurzfristige Erfolge oder auf langanhaltende Lösungen. Genuss und Zurückhaltung. Wie wird mit der Auslebung individueller Bedürfnisse umgegangen?

