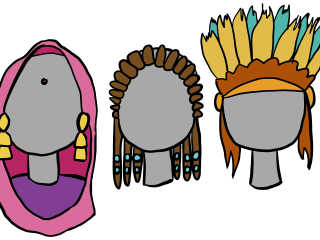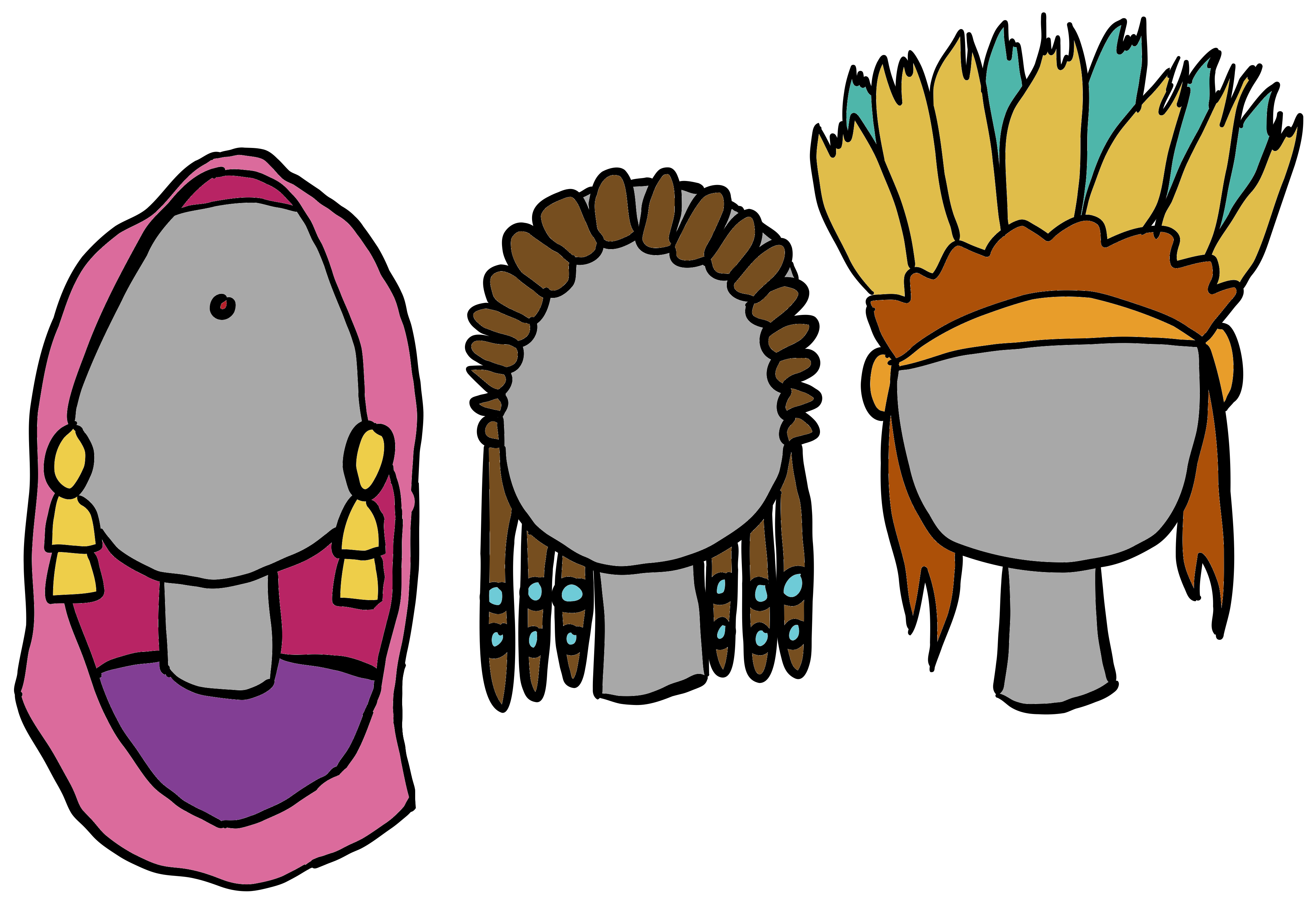 Der Begriff Kulturelle Aneignung (engl. cultural appropiation) beschreibt im weitesten Sinne die Annahme eines kulturellen Aspektes, der nicht zur eigenen Kultur gehört. Kulturelle Aneignung ist besonders deshalb interessant, da sich die Grundlagen kultureller Auseinandersetzungen in Besitzansprüchen und Strategien der Exklusion zeigen (vgl. Hahn 2011, 19). Daher wird kulturelle Aneignung häufig als Diebstahl oder respektlos kritisiert.
Der Begriff Kulturelle Aneignung (engl. cultural appropiation) beschreibt im weitesten Sinne die Annahme eines kulturellen Aspektes, der nicht zur eigenen Kultur gehört. Kulturelle Aneignung ist besonders deshalb interessant, da sich die Grundlagen kultureller Auseinandersetzungen in Besitzansprüchen und Strategien der Exklusion zeigen (vgl. Hahn 2011, 19). Daher wird kulturelle Aneignung häufig als Diebstahl oder respektlos kritisiert.
Forschungsaspekte
Bei Kultureller Aneignung wird eine kulturelle Veränderung fokussiert (vgl. Hahn 2011, 11f). Die Übernahme von einzelnen Elementen einer Kultur, wie z.B. Kleidung, Schmuck oder Ähnliches, fällt aber nicht sofort unter diesen Begriff. Erst, wenn die Verwendung in abwertender, feindlicher oder unreflektierter Weise geschieht und dadurch die jeweilige Kultur unterdrückt oder lächerlich gemacht wird, spricht man von kultureller Aneignung (vgl. Krieg 2019, 105). Vereinzelt wird kulturelle Aneignung auch mit Diebstahl und Zerstörung marginalisierter Kulturen gleichgesetzt (Cuthbert 1998, 257).
Durch den Prozess der Aneignung soll keine Homogenisierung der Kulturen (=eine einheitliche Kultur) und auch keine Fragmentierung der Kulturen (=Zerfall der Kulturen) erreicht werden (vgl. Hahn 2011, 13). Das Ziel besteht eher darin, seine eigene Kultur in neue, andere kulturelle Ideen zu übernehmen. Schlussendlich kann also eine neue Kultur entstehen, die sich aus Aspekten aller beteiligter Einflüsse ergibt (vgl. Hahn 2011, 13f).
Gesellschaftliche Relevanz
Kulturelle Aneignung verläuft dabei allerdings nicht harmonisch und ist gerade in heutiger Zeit ein umstrittenes Thema, das immer wieder den Weg in die Medienlandschaft findet. So berichtet beispielsweise eine US-amerikanische Seite über „11 Celebrities who have been accused of cultural appropriation“ (Seventeen). Dass es allerdings um mehr geht, als sich schuldig zu machen, stellte die ZEIT 2020 fest. Es ginge in der Debatte um „Verletzbarkeit und Begehren (…), den Komplex kultureller Identifikation mit der Dimension des Eigentums“ (ZEIT) und um „die rassistische Struktur der stereotypisierenden Dekontextualisierung“ (ZEIT). Dieser negativen Bewertung gibt die Wissenschaft in Teilen recht. So beschreibt Denise Cuthbert 1998 kulturelle Aneignung als Diebstahl und zeigt eine Zerstörung indigener Kulturen durch erzwungene kulturelle Aneignungen auf (vgl. Cuthbert 1998, 257). Deborah Krieg sagt, dass die „Motivation hinter Formen von Cultural Appropriation (…) vermutlich so heterogen [sind] wie die Personen, die sie ausüben“ (Krieg 2019, 111). Besonders die Frage nach der Motivation ist daher immer wieder Streitpunkt der Debatte.
Beispiele
Ein bekanntes Beispiel für kulturelle Aneignung ist die Verwendung traditioneller indigener Muster und Designs in der Modeindustrie ohne Einbeziehung oder Wertschätzung der ursprünglichen Kultur. Ein konkretes Beispiel ist das „Navajo“-Muster, das von der Navajo-Nation, einer indigenen Gruppe im Südwesten der USA, entwickelt wurde. Dieses Muster wurde von vielen Modefirmen und Designern weltweit verwendet, ohne die Zustimmung der Navajo-Nation einzuholen oder eine angemessene Anerkennung oder Entschädigung anzubieten. Das Navajo-Muster wurde auf Kleidungsstücke, Schuhe und Accessoires gedruckt und vermarktet, wodurch ein kommerzieller Erfolg erzielt wurde, ohne die indigene Gemeinschaft einzubeziehen oder zu respektieren. Dieses Beispiel verdeutlicht die Problematik der kulturellen Aneignung, bei der kulturelle Elemente einer nicht dominanten Kultur, wie z.B. traditionelle Muster oder Designs, von einer dominanteren Kultur genutzt werden, ohne den historischen und sozialen Hintergrund angemessen zu berücksichtigen. Solche Aneignungen können zur Abwertung der Kultur und Identität der ursprünglichen Gemeinschaft führen und zu einer weiteren Marginalisierung beitragen.
Blackfacing ist ebenfalls ein Beispiel für kulturelle Aneignung. Es handelt sich dabei um eine Praxis, bei der sich hellhäutige Menschen dunkel schminken, um ein stereotypes Bild von Schwarzen zu vermitteln. Jahrhundert zurück, als weiße Schauspieler in den USA begannen, schwarze Charaktere in Theatern und Minstrel Shows zu spielen. Die Darstellung der Schwarzen war dabei oft stark überzeichnet und karikiert. Dieses Phänomen ist ein deutliches Beispiel für kulturelle Aneignung, da Weiße sich eine kulturelle Identität und Erfahrung aneignen, die ihnen nicht zusteht. Durch die Aneignung von schwarzem Aussehen, schwarzer Kultur und stereotypen Eigenschaften setzen sie Stereotype fort und tragen zur Entmenschlichung schwarzer Menschen bei. Es wird eine rassistische Tradition aufrechterhalten, in der Schwarze als „Andere“ dargestellt werden und ihre Kultur der Unterhaltung von Weißen dient. Blackfacing stellt somit eine Form der kulturellen Ausbeutung dar, bei der Weiße Schwarze Menschen als Objekte betrachten und ihre Kultur für ihre eigenen Zwecke nutzen. Es spielt auf bestehende rassistische Machtstrukturen und Stereotype an und verfestigt diese. Es ignoriert auch die Tatsache, dass Schwarze Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe häufig Diskriminierung, Rassismus und Unterdrückung erfahren haben und immer noch erfahren.
Karneval ist oft ein Beispiel für kulturelle Aneignung, da es ein Fest ist, bei dem Menschen verschiedene Kostüme und Verkleidungen tragen, um eine bestimmte Persönlichkeit oder Figur darzustellen. Diese Kostüme sind oft von verschiedenen Kulturen und Traditionen aus der ganzen Welt inspiriert. Ein Grund für die kulturelle Aneignung könnte sein, dass Menschen, die sich verkleiden, oft wenig über die kulturelle Bedeutung oder den Hintergrund des Kostüms wissen. Sie wählen ein Kostüm vielleicht nur aus ästhetischen oder unterhaltsamen Gründen, ohne sich über die tieferen kulturellen Bedeutungen Gedanken zu machen. Ein weiterer Grund könnte sein, dass im Karneval verschiedene Kulturen und Traditionen oft auf humorvolle und satirische Weise dargestellt werden. Dabei werden häufig Stereotypen und Klischees verwendet, die jedoch oft vereinfacht oder verzerrt dargestellt werden. Dies kann zu einer Verletzung der kulturellen Identität und Würde führen.
Es ist wichtig anzumerken, dass kulturelle Aneignung ein umstrittenes Thema ist und dass es unterschiedliche Meinungen dazu gibt. Einige argumentieren, dass der Karneval ein Fest der Kreativität und des kulturellen Austauschs ist, bei dem es erlaubt ist, verschiedene Kulturen zu erkunden und sich gegenseitig zu inspirieren. Andere sehen in der kulturellen Aneignung eine Form von Respektlosigkeit und Machtungleichgewicht, da dominante Kulturen oft kulturelle Elemente von marginalisierten Kulturen übernehmen und verwenden, ohne die negativen Auswirkungen oder Hintergründe zu verstehen.
Hier geht es zum Überblick aller Lexikonartikel…
Literatur
Cuthbert, Denise (1998): Beg, borrow or steal: The politics of cultural appropriation. In: Postcolonial Studies, Bd. 1 (2). London, Routledge.
Hahn, Hans Peter (2011): Antinomien kultureller Aneignung: Einführung. In: Zeitschrift für Ethnologie, Bd. 136. Berlin, Dietrich Reimer Verlag.
Krieg, Deborah (2019): Alles nur geklaut. WTF ist eigentlich Cultural Appropriation, in: Bendersen, Eva u.a. (Hrsg.): Trigger Warning. Identitätspolitik zwischen Abwehr, Abschottung und Allianzen, Berlin, 2019 (S.105-114), Verbrecher Verlag.
Seventeen: https://www.seventeen.com/celebrity/g22363821/cultural-appropriation-examples-celebrities/ (zuletzt eingesehen 19.09.2020).
Zeit: https://www.zeit.de/kultur/2020-05/kulturelle-aneignung-popkultur-stereotyp-imitation-postkolonialismus (zuletzt eingesehen 19.09.2020).
Zeit: https://www.zeit.de/kultur/2020-05/kulturelle-aneignung-popkultur-stereotyp-imitation-postkolonialismus/seite-3 (zuletzt eingesehen 19.09.2020).
Kulturelle Aneignung – Cultural appropriation | IKUD Glossar
Transkript zum Erklärfilm
Der Begriff kulturelle Aneignung beschreibt die Übernahme oder das Ausleben eines kulturellen Aspektes, der nicht zur eigenen Kultur gehört. Die Übernahme von einzelnen Elementen einer Kultur, wie z.B. Kleidung, Schmuck oder Ähnlichem, fällt aber nicht sofort unter diesen Begriff. Erst, wenn die Elemente abwertend, feindlich oder unreflektiert übernommen werden, spricht man von kultureller Aneignung. Denn dadurch wird die jeweilige Kultur unterdrückt, lächerlich gemacht oder in ihrer kulturellen Identität bedroht.
Eine wahre interkulturelle Begebenheit wird in dem Buch geschildert:
Opferhuhn
Eine Freundin von mir machte mir ihrer Familie Urlaub in Mexiko. Auf dem Weg ins Innere des Landes kamen sie an einem kleinen Dorf mit einer schönen Kirche vorbei. Zur selben Zeit fand in der katholischen Kirche ein seltenes Ritual statt. Es lagen viele Pinienzweige und ca. 200 Kerzen um ein Huhn und einem Mann herum auf dem Boden. Bis auf den einen Mann, der sich innerhalb des Kerzenkreises befand, saßen alle Leute in der Kirche auf dem Boden. Der Mann in der Mitte des Kreises opferte das Huhn.
Nach der Opfergabe tranken alle Anwesenden ein kohlensäurehaltiges Getränk, um mit dem anschließenden Rülpsen die bösen Geister aus dem Körper zu treiben. Anschließend träufelte der Priester das Getränk auf das tote Tier. Mit gleicher Sorgfalt sprenkelte der Priester die braune Brause auch auf die bunten Kerzen, die er präzise auf dem Kirchenboden aufgereiht hatte. Monoton murmelte er sein Gebet, wiederholte unablässig Formeln, die das Kirchenschiff erfüllten wie der harzige Duft der überall ausgelegten Pinienzweige.
In dem ganzen Dorf gibt es nur 20 Priester. Sie erben ihr Amt von ihren Vorfahren. Heute gibt es nur noch wenige Kirchen, in der eine solche Opfergabe gestattet ist. Dennoch ist diese Prozedur ein sehr beliebtes Ziel für viele Touristen. Allerdings ist das Fotografieren für Dorffremde, egal ob Mexikaner oder Ausländer, grundsätzlich verboten. Dabei wollen sich die Einheimischen bloß schützen. Nach ihrem Glauben raubt ihnen die Kamera ihre Seele. Sie sind dann verletzlicher und anfälliger für Krankheiten. Somit schützen sie ihre Seele und ihren Geist. Die Dorfpolizisten, die darauf besonders Acht geben, werden auch die Ältesten genannt. Bei Regelverstößen kommt es auch einmal vor, dass die Dorfpolizei nicht nur Bußgeld verlangt, sondern die Touristen auch für einen Tag ins Gefängnis steckt.