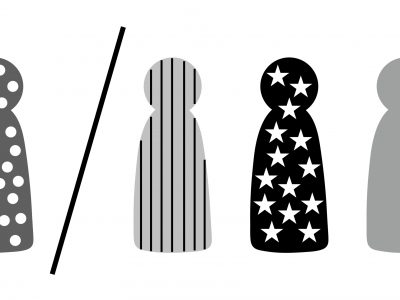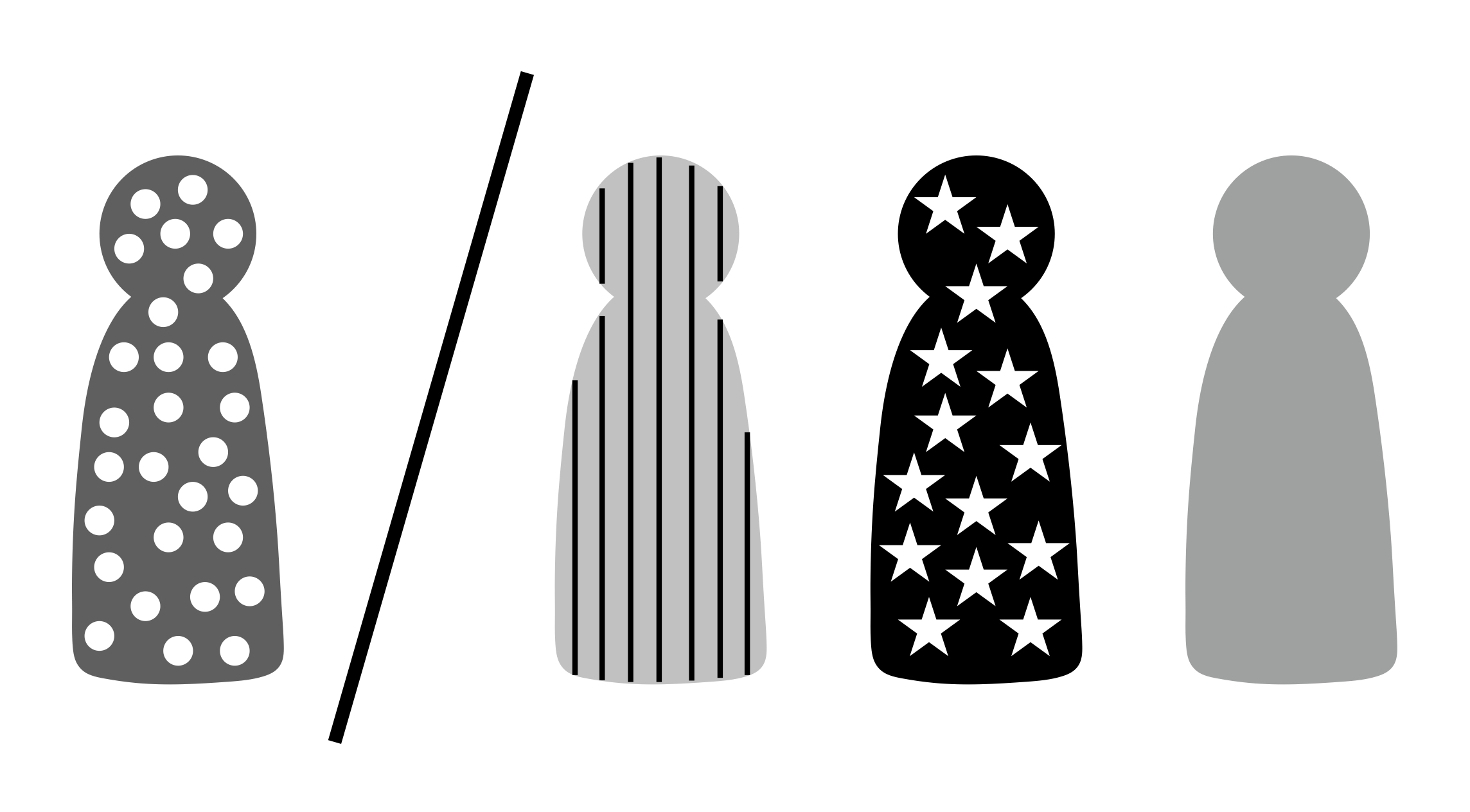Der Begriff Othering kann vom englischen Wort other „andersartig“ abgeleitet werden und erhält durch die Endung -ing seinen aktiv handelnden Charakter. Ins Deutsche könnte er mit „Jemanden anders(artig) machen“ übersetzt werden. Auch wird in der Literatur von „Veranderung“ beziehungsweise „Fremd-Machung“ gesprochen.
Das ‚Eigene‘ und das ‚Fremde‘
Der Ausdruck beschreibt einen konstruierten Prozess, der Menschen als ‚Andere‘ bestimmt, die es von einem eigenen ‚Wir‘ zu unterscheiden und abzugrenzen gilt. Während das eigene soziale Image verstärkt positiv hervorgehoben wird, wird gleichzeitig jemand als ‚fremd‘ oder ‚andersartig‘ klassifiziert. Eine dichotome Differenzierung und sogar Distanzierung zu anderen Menschen findet statt, um die eigene ‚Normalität‘ zu bestätigen. Über die externe Zuschreibung von Minderwertigkeit wird die eigens in Anspruch genommene Überlegenheit gestärkt. Diese häufig auch biologistische Argumentation bezieht sich jedoch nicht nur auf die soziale Stellung von Menschen in der Gesellschaft. Auch Klassenzugehörigkeit, Glaubensvorstellungen, Ethnizität, Sexualität, Geschlecht und Nationalität sind mögliche Kategorien.
Macht definiert Zugehörigkeit
So beschreibt Riegel das binäre Verhältnis als ein hegemoniales: „Unter ‚Konstruktionen von Anderen‘ werden, mit Bezug auf postkoloniale Theorien und die Cultural Studies, soziale Prozesse, Repräsentationen, Diskurse und Praxen verstanden, durch die vor der Folie einer selbstverständlichen, wirkungsmächtigen Normalität sozial bedeutsame Differenzen und Grenzziehungen hergestellt und Menschen zu Anderen, Nicht-Zugehörigen gemacht werden. Sie werden dabei einer hegemonialen Differenzordnung unterworfen und bekommen eine inferiore Position zugewiesen“ (Riegel 2016, 8).
Philosophische Wurzeln
Bereits Hegel beschäftigte sich in seiner Phänomenologie des Geistes (1807) mit der Frage, wie die Wahrnehmung des Selbst mit der Konstruktion und Abgrenzung zum Anderen zusammenhängt. Auch Beauvoir beeinflusste mit ihrem Konzept der Alterität vor allem gesellschaftliche Geschlechterdiskurse. Den Begriff Othering prägte später die Literaturwissenschaftlerin Gayatri Chakravorty Spivak.
Kritik
Obwohl der Begriff „Othering“ hilfreich sein kann, um auf Mechanismen von Macht, Unterdrückung und Diskriminierung aufmerksam zu machen, gibt es auch Kritik an seiner Verwendung:
1. Vereinfachung und Ungenauigkeit: Einige Kritiker argumentieren, dass der Begriff „Othering“ zu vereinfachend sei und die Komplexität sozialer Beziehungen und Identitäten nicht angemessen widerspiegele. Durch die Verwendung des Begriffs „Othering“ könnten komplexe soziale Strukturen und individuelle Erfahrungen vernachlässigt werden.
2) Binäre Logik: „Othering“ basiert auf einer binären Logik von „Wir“ und „die Anderen“. Dies impliziert, dass es klare Abgrenzungen und Kategorisierungen zwischen Gruppen gibt. Diese binäre Logik kann jedoch dazu führen, dass die Unterschiede zwischen den Gruppen verstärkt werden und es weniger Raum für Zusammenarbeit und Verständigung gibt.
3) Essentialisierung: Othering kann auch dazu führen, dass die als „anders“ markierten Gruppen essentialisiert werden. Das bedeutet, dass einzelnen Gruppen bestimmte Eigenschaften oder Merkmale zugeschrieben werden, die als stereotypisierend oder stigmatisierend empfunden werden können.
4. Vernachlässigung struktureller Dimensionen: „Othering“ betont häufig individuelle Vorurteile und Diskriminierung, vernachlässigt aber häufig strukturelle und institutionelle Dimensionen. Kritiker argumentieren, dass es wichtig ist, nicht nur individuelle Einstellungen zu betrachten, sondern auch strukturelle und systemische Faktoren, die zur Aufrechterhaltung von Ungleichheiten beitragen.
5) Eurozentrismus und kulturelle Dominanz: Einige Kritiker bemängeln, dass der Begriff „Othering“ oft aus einer eurozentrischen Perspektive verwendet wird und kulturelle Dominanz und Normalität perpetuiert. Dies könne dazu führen, dass bestimmte Gruppen als „die Anderen“ markiert werden, während andere als normal oder normal angesehen werden, was zu Hierarchien und Ungleichheiten beitrage.
Teste Dein Wissen zu Othering – hier geht’s zum Lückentext.
Literatur
Hier geht es zum Überblick aller Lexikonartikel…
Mecheril, Paul (2009): „Diversity“. Differenzordnungen und Modi ihrer Verknüpfung. https://heimatkunde.boell.de/2008/07/01/diversity-differenzordnungen-und-modi-ihrer-verknuepfung [23.04.2018].
Riegel, Christine (2016): Bildung, Intersektionalität, Othering. Pädagogisches Handeln in widersprüchlichen Verhältnissen. Bielefeld: Transcript.
Spivak, Gayatri Chakravorty (1985): The Rani of Simur. An Essay in Reading the Archives. In: Barker, Francis et al. (Hrsg.): Europe and its Others. Colchester: University of Essex, 128–151.
Weiterführendes Lernmaterial: Interkulturell kompetent kommunizieren und handeln
Transkript zum Erklärfilm
Der Begriff Othering kann vom englischen Wort other „andersartig“ abgeleitet werden. Ins Deutsche könnte er mit „Jemanden andersartig machen“ übersetzt werden. Auch wird in der Literatur von „Fremd-Machung“ gesprochen. Der Ausdruck beschreibt einen Prozess der Gruppenbildung, bei dem bestimmte Menschen als ‚Andere‘ bestimmt und so vom eigenen ‚Wir‘ abgegrenzt werden. Während das eigene Image positiv hervorgehoben wird, wird gleichzeitig jemand als ‚andersartig‘ beziehungsweise minderwertig klassifiziert. Anschließend erfolgt eine Distanzierung zu den als fremd betrachteten Menschen. Mögliche Kategorien des Otherings sind zum Beispiel Klassenzugehörigkeit, Glaubensvorstellungen, Ethnizität, Sexualität und Nationalität.
Wahre interkulturelle Begebenheiten werden in dem Buch Intercultural stories: Menschliche Begegnungen aus aller Welt – lustig, lehrreich, lebensecht von Benjamin Haag geschildert:
Totentanz
Anfang dieses Jahres kam ein Freund bei einem Unfall ums Leben. Ungefähr zwei Wochen später fand die Trauerfeier und die Beerdigung statt. Da sein Herkunftsland Kenia war, waren hauptsächlich Kenianer anwesend. Ein Freund und ich kamen in Hemd und Sakko und setzten uns in eine freie Reihe. Beim Umschauen fiel uns auf, dass wir fast die einzigen speziell angezogenen Gäste waren. Kurz darauf begann die Trauerfeier. Anfangs sprach wie von uns erwartet ein Priester auf Englisch. Anschließend ließen einige Freunde des Verstorbenen Anekdoten aus seinem Leben verlauten und wünschten der Familie Kraft. Danach kam es zu einem seltsamen, aber erfreulichen Bruch.
Ein Buffet wurde aufgebaut, Freundinnen begannen eine Tanzchoreographie und andere fingen an, Lieder zu singen. So wurde man fast gezwungen, die Trauer hinter sich zu lassen. Lachende Frauen forderten uns auf, Essen und Getränke zu nehmen, was wir dann auch taten. Als wir einige Zeit später unsere Sachen packten, um die Trauerfeier zu verlassen, tanzten und sangen immer noch einige Gäste, andere packten sich Essen in Alufolien ein oder unterhielten sich. Die fröhliche Feier klang so langsam aus.
Matemahl
In den Semesterferien 2009 absolvierte ich mein zweites Schulpraktikum an einer deutschen Schule in Argentinien. Hier arbeiteten zum größten Teil argentinische Lehrer, aber auch deutschstämmige, die zwar in Argentinien aufwuchsen, deren Eltern oder Großeltern aber aus Deutschland kamen. In Argentinien wurde viel Matetee getrunken. Das Besondere dabei war, dass es so etwas wie ein Gruppenritual darstellte. Alle Menschen tranken gemeinsam einen Matetee aus demselben Gefäß, der Kalebasse und benutzten denselben Strohhalm. Es gab immer eine Art Gastgeber, der den Matetee wieder neu aufgoss und das Gefäß herumreichte. Auch im Lehrerzimmer der Schule wurde das Getränk gemeinsam eingenommen.
Eines Morgens saß ich vor Unterrichtsbeginn im Lehrerzimmer und beobachtete das Ritual erstmalig unter Kollegen (ich wusste, dass Freunde zusammen Mate tranken, aber dass auch Kollegen denselben Strohhalm teilten, war mir nicht bewusst). Das Trinkgefäß ging reihum und ich muss zugeben, dass ich etwas angewidert von dem Ritual war, da es für mich nicht vorstellbar war, an demselben Strohhalm zu trinken wie Arbeitskollegen, denen man eigentlich nicht so nah ist wie Freunden. Während ich das Geschehen beobachtete, bekam ich Angst, dass sie mir das Getränk anbieten würden und ich dann aus Höflichkeit an dem Strohhalm ziehen müsste. Doch dies trat nicht ein, das Gefäß ging umher und wurde mir nicht gereicht, was mich wiederum nachdenklich stimmte.
Tip
Als ich mit drei Freunden im Urlaub auf Lanzarote war, gingen wir eines Abends in einem Restaurant essen. Da wir in einem spanischsprachigen Land waren, bemühten wir uns, Spanisch zu sprechen – auch wenn unsere Spanischkenntnisse sehr begrenzt waren. Eine Freundin wollte ein großes Wasser für alle zusammen bestellen. Der Kellner guckte uns etwas skeptisch an, nickte dann aber und ging zum Kühlschrank. Zurück kam er mit einer großen Flasche Bier, stellte sie in die Mitte und gab jedem ein Bierglas. Er guckte abwartend. Wir verstanden nicht, was vor sich ging. Wir hatten doch Wasser bestellt. Brachte er uns Bier, weil wir Deutsche waren? Hatte sich das Klischee der biertrinkenden Deutschen schon bis Lanzarote seinen Weg gesucht? Als wir so verdutzt die Flasche anschauten, fragte er, ob alles nach unseren Wünschen sei. Wir wiederholten auf Spanisch, dass wir doch ein Wasser bestellt hätten (wieder mit der Verwendung der falschen Vokabel, die Bier bedeutete) und deuteten auf die Wasserflasche eines Nachbartisches. Der Kellner erklärte uns ganz freundlich unser Vokabelmissverständnis und brachte uns schließlich unsere Flasche Wasser.
Als wir mit dem Essen fertig waren, kramten wir wieder in unserem Spanischvokabular und baten nach der Rechnung. Der Kellner fing an zu lachen und wiederholte das spanische Wort für Rechnung, was auf Lanzarote jedoch Strafzettel bedeutete, wie er uns gestenreich verständlich machte. Als das geklärt war, bekamen wir unsere Rechnung, bezahlten, legten Trinkgeld dazu und kassierten mal wieder einen schrägen Blick. Er wollte uns unbedingt unser Trinkgeld zurückgeben und wir wollten ihm unbedingt verdeutlichen, dass das Trinkgeld und schon okay so sei.
Erst einige Wochen später fanden wir heraus, dass man auf Lanzarote wohl nur ca. 50 Cent Trinkgeld gibt. Wir rechneten brav die 10% aus und rundeten noch etwas auf, sodass wir um die 8 Euro Trinkgeld dort ließen.