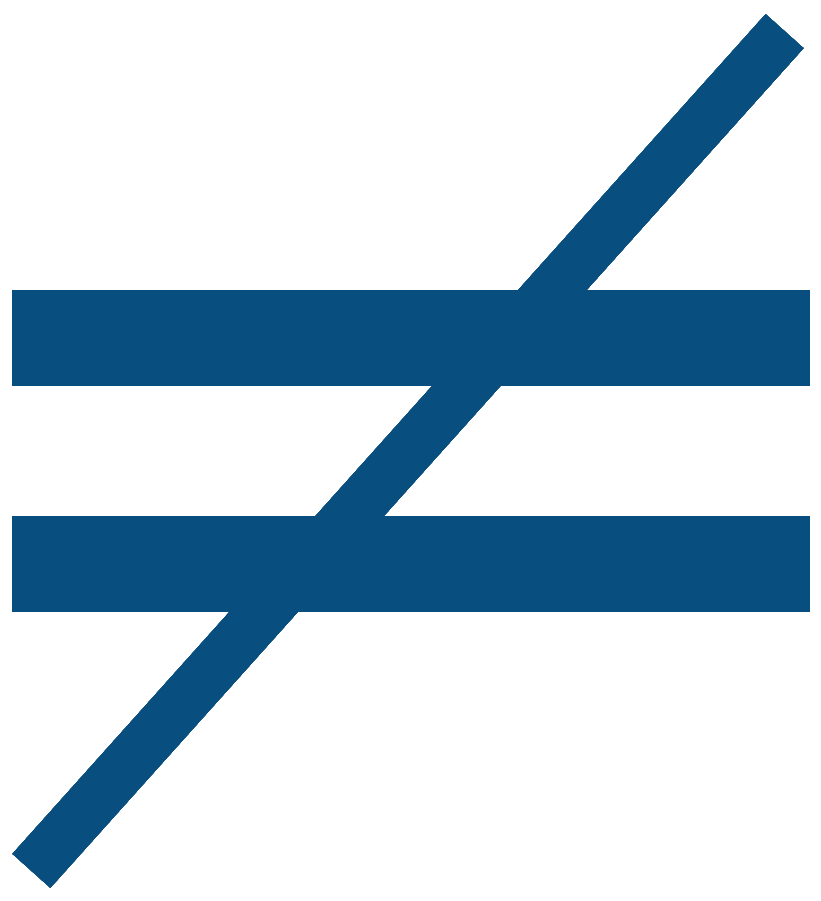 Der Begriff Heterogenität lässt sich nicht eindeutig definieren. Wittig nennt Synonyme, wie beispielsweise Verschiedenartigkeit, Diversität, Andersartigkeit und Ungleichheit (vgl. Wittig 2014, 14). Im Online-Kulturglossar von Schönhuth ist Heterogenität als „ein Ausdruck für Vielfalt“ zu verstehen. Interessant erscheint die Herangehensweise von Prengel, die Heterogenität auf drei Bedeutungsebenen definiert, nämlich als Verschiedenheit, Veränderlichkeit und Unbestimmtheit (vgl. Prengel 2005, 21).
Der Begriff Heterogenität lässt sich nicht eindeutig definieren. Wittig nennt Synonyme, wie beispielsweise Verschiedenartigkeit, Diversität, Andersartigkeit und Ungleichheit (vgl. Wittig 2014, 14). Im Online-Kulturglossar von Schönhuth ist Heterogenität als „ein Ausdruck für Vielfalt“ zu verstehen. Interessant erscheint die Herangehensweise von Prengel, die Heterogenität auf drei Bedeutungsebenen definiert, nämlich als Verschiedenheit, Veränderlichkeit und Unbestimmtheit (vgl. Prengel 2005, 21).
Heterogenität vs. Homogenität
Heterogenität kann als Gegenteil von Homogenität betrachtet werden. Wird etwas als eine homogene Einheit beschrieben, wird es als „aus hochgradig einheitlichen Bestandteilen zusammengesetzt und ein umfassendes Ganzes” (Krossa 2018, 53) dargestellt.
Das Substantiv Heterogenität ist eine Ableitung vom Adjektiv heterogen, das seinen Ursprung im griechischen Wort heterogenḗs hat, das „von anderer Art, Gattung, unterschiedlichem grammatischem Geschlecht, verschiedenartig zusammengesetzt” (DWDS 2018) bedeutet.
Soziologische Betrachtungsweise
Krossa definiert den Begriff aus einer soziologischen Perspektive: „Im Gegensatz zum Homogenitätsansatz ist die dann zugrunde liegende Annahme zunächst, dass Ort und Raum immer weniger oder sogar gar nicht mehr deckungsgleich sind” (Krossa 2018, 67).
Es kommt zu einer Überlappung des Sozialen und Räumlichen,
- wenn gestapelte Sozialräume an einem geographischen Ort gleichzeitig und parallel existieren oder
- wenn sich ein Sozialraum über mehr als einen Ort erstreckt (vgl. Krossa 2018, 67).
Krossa beruft sich auch auf Werke des polnischen Kulturtheoretikers Zygmunt Bauman, der sich mit der ‚flüssigen Moderne‘ beschäftigt. Die Gegenwart, in der es keine vorgegebenen Muster mehr gäbe, überträgt er auch auf sein Konzept der Gesellschaft. Er distanziert sie vom traditionellen Rahmen des Nationalstaates, und mithilfe der Metapher der Flüssigkeit nimmt er das Differenzkonzept als Prinzip. Er analysierte die gegenwärtigen Muster der Sozialformen, die darauf basieren, dass sich ein Individuum gleichzeitig und wandelbar mehreren Sozialgruppen zugehörig fühlen kann. Krossa erwähnt Theorien, die das Individuum in den Vordergrund gestellt haben – das Individuum, das sich aber zur Oberflächlichkeit entwickelt. Das könne auch bedeuten, es wird immer wichtiger, viele Identitäten zu pflegen (vgl. Krossa 2018, 73 f.).
Homo- und Heterogenität in der Balance?
Laut Krossa ist die Differenzforschung erfolgreich, wenn sie sich auf Mikroebenen bezieht, wird aber problematisch, wenn die Begriffe auf der Makroebene theoretisiert werden sollen (vgl. Krossa 2018, 68). Sie schreibt über die Entwicklung des Zusammenseins beider Begriffe in der heutigen Soziologie: „Generell zeigt die Betrachtung gegenwärtiger Trends in der Soziologie, dass sich der Schwerpunkt der Balance (oder eher: des Ungleichgewichts) zwischen Homogenität und Heterogenität verschiebt, und zwar in Richtung der Vermutung, dass die Problematik der Heterogenität heute die wichtigere, dringendere ist.“ (Krossa 2018, 68)
Dieses Phänomen erklärt sie so: „Viele Autoren übertreiben diesen Aspekt [der Homogenität] nun, indem sie Heterogenität zum dominanten, wenn nicht gar einzig relevanten Charakteristikum des gegenwärtigen Sozialen erklären” (Krossa 2018, 68). Als eine Konsequenz dessen gibt sie unter anderen an, dass ForscherInnen zum Thema Gesellschaft das Konzept der Gesellschaft an sich hinterfragen und feststellen, dass es durch das der Differenz überholt sei (vgl. Krossa 2018, 68).
Bei der Forschung kommt es aber auch zur Simplifizierung, weil Homo- und Heterogenität nur als Gegenteile betrachtet, nicht aber zusammen beschrieben werden. Das führt zur Reversion – um das ‚Zuviel‘ an Heterogenität zu vermeiden, wird die Homogenität überbetont. Das ist beispielsweise in Zuwanderungs- und Migrationsdebatten zu sehen.
Kulturelle Heterogenität
Kulturelle Heterogenität bezieht sich auf die Vielfalt der Kulturen innerhalb einer Gesellschaft. Sie beschreibt die Existenz verschiedener ethnischer, religiöser, sprachlicher und sozialer Gruppen und ihre unterschiedlichen kulturellen Praktiken, Traditionen, Werte und Normen. Sie entsteht durch historische, migratorische und soziale Prozesse. Historische Ereignisse wie die Kolonialisierung, imperialistische Expansion oder politische Konflikte können dazu führen, dass verschiedene Kulturen auf engem Raum zusammenleben. Migration ist ein weiterer Faktor, der zur kulturellen Heterogenität beiträgt. Menschen, die aus anderen Ländern kommen, bringen ihre eigene Kultur mit und bereichern die kulturelle Landschaft des Aufnahmelandes. So kann beispielsweise die Migration von Menschen aus verschiedenen europäischen Ländern nach Amerika zu einer kulturellen Vielfalt führen. Kulturelle Heterogenität kann auch innerhalb von Gesellschaften entstehen, in denen verschiedene soziale Gruppen mit unterschiedlichen historischen, religiösen oder ethnischen Hintergründen leben. In vielen Ländern gibt es indigene Bevölkerungsgruppen, die ihre eigenen Traditionen, Sprachen und Werte haben und oft von der vorherrschenden Kultur abweichen. Diese Heterogenität kann dazu führen, dass sich Menschen unterschiedlichen kulturellen Identitäten zugehörig fühlen und eine Vielfalt von Lebensweisen und Ausdrucksformen entwickeln. Diese Form von Heterogenität bringt eine Reihe von Vorteilen mit sich. Zum einen bereichert sie die kulturelle und intellektuelle Vielfalt einer Gesellschaft. Unterschiedliche Perspektiven und Ansätze können zu einer Dynamik des kulturellen Austauschs und der kreativen Innovation führen. Das Zusammenleben in einer heterogenen Gesellschaft kann auch zu einer größeren Toleranz und Offenheit gegenüber anderen Kulturen führen. Allerdings können auch Herausforderungen mit der kulturellen Heterogenität einhergehen. Unterschiedliche kulturelle Praktiken und Wertesysteme können zu Spannungen und Konflikten führen. Es kann zu Missverständnissen und Vorurteilen kommen, wenn Menschen mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen aufeinandertreffen. Diskriminierung und soziale Ungerechtigkeit gegenüber bestimmten Gruppen können ebenfalls ein Ergebnis von kultureller Heterogenität sein.
Heterogenität in der Schule
Heterogenität in der Schule beschreibt die Vielfalt der Schülerinnen und Schüler in Bezug auf ihre verschiedenen Merkmale und Hintergründe. Sie kann bestimmte Herausforderungen mit sich bringen, aber bietet auch eine große Chance für ein vielfältiges Lernumfeld. Diese Vielfalt kann sich auf verschiedene Aspekte beziehen, wie beispielsweise:
- Kulturelle Heterogenität: Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichem kulturellen Hintergrund bringen verschiedene Traditionen, Sprachen und Wertvorstellungen mit in die Schule.
- Soziale Heterogenität: Schülerinnen und Schüler kommen aus unterschiedlichen sozialen Schichten, was sich auf ihre Lebensbedingungen, ihre finanziellen Mittel und ihre Bildungserfahrungen auswirken kann.
- Leistungsbezogene Heterogenität: Schülerinnen und Schüler unterscheiden sich in ihrem Lernstand, ihren Fähigkeiten und Begabungen. Einige Schülerinnen und Schüler können schneller lernen und haben höhere Leistungen, während andere mehr Unterstützung und Förderung benötigen.
- Sprachliche Heterogenität: In vielen Schulen gibt es Schülerinnen und Schüler, deren Muttersprache nicht die Unterrichtssprache ist. Dies kann zu besonderen Herausforderungen im Unterricht führen.
- Religiöse Heterogenität: Schülerinnen und Schüler gehören verschiedenen Religionen oder Glaubensrichtungen an und bringen unterschiedliche religiöse Praktiken und Überzeugungen mit in die Schule.
Hier geht es zum Überblick aller Lexikonartikel…
Literatur
Digitales Wörterbuch der Deutschen Sprache (DWDS). https://www.dwds.de/wb/heterogen [19.06.18].
Krossa, Anne Sophie (2018): Gesellschaft. Betrachtungen eines Kernbegriffs der Soziologie. Wiesbaden: Springer.
Prengel, Annedore (2005): Heterogenität in der Bildung – Rückblick und Ausblick. In: Bräu, Karin/ Schwerdt, Ulrich (Hrsg.): Heterogenität als Chance. Vom produktiven Umgang mit Gleichheit und Differenz in der Schule. Münster: LIT, 19–35.
Schönhuth, Michael: kulturglossar.de. http://www.kulturglossar.de/html/h-begriffe.html [19.06.2018].
Wittig, Marietta-Titine Ve (2014): Heterogenität – Belastung oder pädagogische Herausforderung? Eine Untersuchung von Lehrertypen an staatlichen Berliner Berufsschulen im Berufsfeld Wirtschaft und Verwaltung in Bezug auf den Umgang mit Schülervarianzen. Berlin.
Heterogenität (Grundbegriffe der Politischen Bildung) (profession-politischebildung.de)
Transkript zum Erklärfilm
Der Begriff Heterogenität lässt sich nicht eindeutig definieren. Er umfasst allgemein Verschiedenartigkeit, Uneinheitlichkeit und Ungleichheit. Heterogenität bezieht sich also auf die Unterschiedlichkeit oder Vielfältigkeit innerhalb einer Gruppe oder eines Systems. Heterogenität prägt das kulturelle Miteinander und erfordert Lernbereitschaft: Um für Fremdes offen zu sein und Verschiedenartigkeit als Chance zu ntzen, müssen zunächst Vorurteile abgebaut werden.
Eine wahre interkulturelle Begebenheit wird in dem Buch geschildert:
Da lang!
Es war mein fünfter Tag in der chinesischen Stadt Hangzhou. Ich war alleine unterwegs auf der Suche nach dem Nachtmarkt. Der Weg wurde mir zuvor von der chinesischen Frau meines Freundes erklärt. Leider half mir die Beschreibung nicht weiter und so verirrte ich mich. Auf dem Weg zurück zur Hauptstraße fragte ich Chinesen auf Englisch nach dem Weg.
Leider verstehen die wenigsten Chinesen außerhalb der Großstadt Englisch. Doch so leicht wollte ich nicht aufgeben. Mit meinem Handy, einem kleinen Wörterbuch und einer China-App fragte ich mich durch die Stadt. Nachdem ich ein paar Stunden durch die Gegend geschickt wurde und mir jeder Chinese eine andere Richtung zeigte, verzweifelte ich und trat den Rückzug an. Der Weg zu der Gastfamilienwohnung war einfach, aber ich hatte den Nachtmarkt leider nicht gefunden.
Angekommen fragte ich, ob mein chinesischer Fragesatz falsch sei. Der Satz war korrekt und jetzt erfuhr ich, was schiefgegangen war. Bei den Chinesen ist es oberstes Gebot, nicht das Gesicht zu verlieren. Wenn man einen Chinesen nach dem Weg fragt, wird er dir in jedem Fall eine Antwort geben. Ob diese Antwort der Wahrheit entspricht, ist eine andere Sache. Ein Chinese würde niemals zugeben, dass er die Antwort auf die ihm gestellte Frage nicht beantworten kann. Lieber wird in irgendeine Richtung gezeigt, um sein Gesicht nicht durch Unwissenheit zu verlieren.
