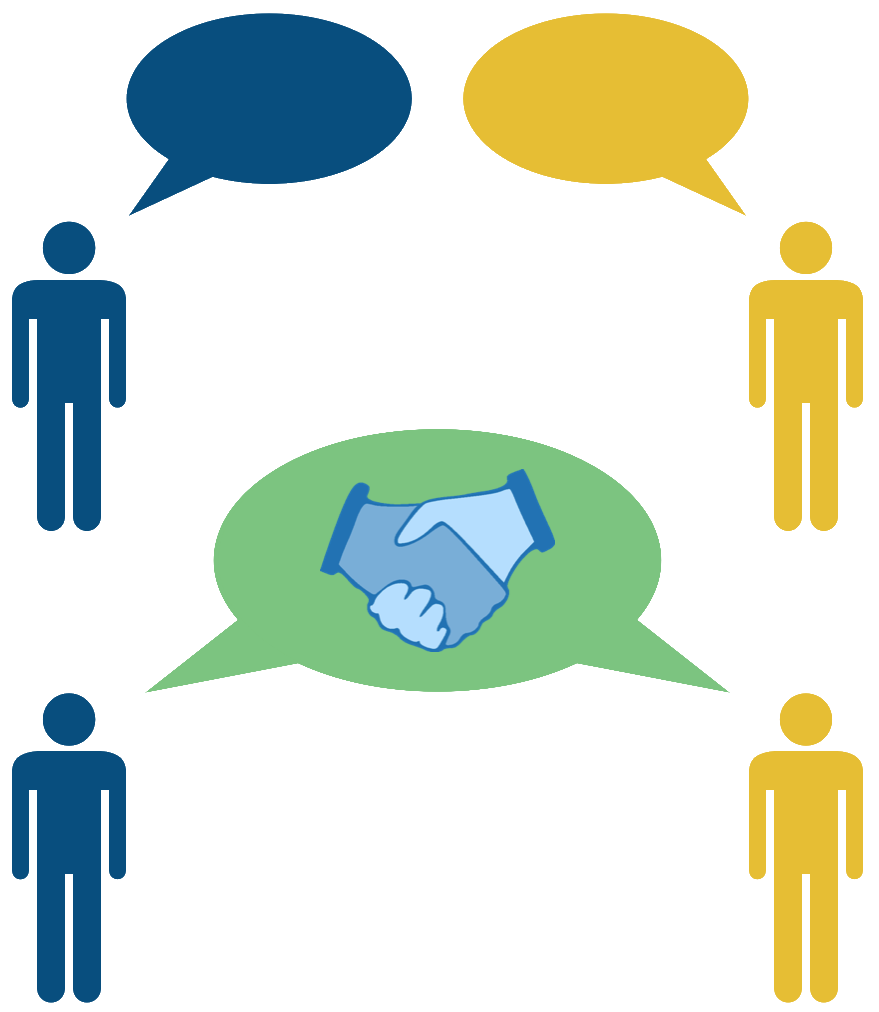 Der australische Germanist Craig Volker erfuhr Ende der 1970er Jahre in der australischen Stadt Goldcoast von einer Schülerin, die bei sich zu Hause in Papua-Neuguinea Deutsch spreche. So entdeckte der Linguist ein damals noch unbekanntes Kreoldeutsch, das als ‚Unserdeutsch‘ bezeichnet wird (vgl. welt.de 2016). Diese auf Deutsch basierte Kreolsprache wird heutzutage in Papua-Neuguinea von etwa 100 Menschen gesprochen (vgl. Haarmann 2002, 268). Im Vergleich zu Unserdeutsch, das sehr wenige Menschen sprechen, entwickelte sich in Papua-Neuguinea auf der Basis von Englisch eine eigene Pidgin-Sprache namens Tok Pisin, die heutzutage sogar von ca. 2,5 Millionen Menschen gesprochen wird (vgl. Haarmann 2002, 361).
Der australische Germanist Craig Volker erfuhr Ende der 1970er Jahre in der australischen Stadt Goldcoast von einer Schülerin, die bei sich zu Hause in Papua-Neuguinea Deutsch spreche. So entdeckte der Linguist ein damals noch unbekanntes Kreoldeutsch, das als ‚Unserdeutsch‘ bezeichnet wird (vgl. welt.de 2016). Diese auf Deutsch basierte Kreolsprache wird heutzutage in Papua-Neuguinea von etwa 100 Menschen gesprochen (vgl. Haarmann 2002, 268). Im Vergleich zu Unserdeutsch, das sehr wenige Menschen sprechen, entwickelte sich in Papua-Neuguinea auf der Basis von Englisch eine eigene Pidgin-Sprache namens Tok Pisin, die heutzutage sogar von ca. 2,5 Millionen Menschen gesprochen wird (vgl. Haarmann 2002, 361).
Abgrenzung
Grundsätzlich ist es schwierig, die Pidgin-Sprache von der Kreolsprache* eindeutig abzugrenzen, da der Übergang fließend ist. Jedoch bezeichnet die Pidgin-Sprache eine „zweckbestimmte Handelskontaktsprache oder Handelshilfssprache, die sich entwickelt hat, um die kommunikativen Bedürfnisse zu befriedigen, die sich bei Handel und Geschäft im Bereich von Überseehäfen ergeben“ (Lewandowski 1994, 815). Eine Pidgin-Sprache entsteht also in einer sprachlichen Notsituation, beim Kontakt zwischen Sprechern von zwei oder mehr Sprachen ohne gegenseitiges Sprachverständnis (vgl. Bußmann 2002, 518). Wird die Pidgin-Sprache nativisiert, d. h. entwickelt sie sich zu einer Muttersprache, so wird sie Kreolsprache genannt.
Herkunft
Zwar ist die Herkunft des Begriffs nicht eindeutig geklärt, im Rahmen der Forschung wird allerdings angenommen, dass der Begriff Pidgin auf eine chinesische Aussprache des englischen Wortes business „Geschäft, Handel“ zurückzuführen ist (vgl. Bußmann 2002, 518). Pidgin-Sprachen sind in den Überseekolonien entstanden, als die Sprachen der europäischen Machthaber (Englisch, Französisch, Spanisch, Niederländisch, Portugiesisch) die Rolle der Spendersprachen übernahmen und zu Verkehrssprachen wurden (vgl. Bußmann 2002, 518). Dabei ist die Spendersprache eine „dominante, prestigebesetzte, sozial höher bewertete Varietät innerhalb einer Sprachgemeinschaft, die die weniger hoch bewertete Varietät nachhaltig beeinflusst“ (Bußmann 2002, 668 f.).
Klassifizierung
Durch die folgenden Merkmale wird die Pidgin-Sprache als solche klassifiziert:
- Sie wird von niemandem als Muttersprache gesprochen.
- Sie hat vereinfachte phonologische, morphologische und syntaktische Strukturen.
- Sie hat einen stark reduzierten Wortschatz.
- Sie wird in der Regel nicht geschrieben.
- Sie dient den verschiedenen ethnischen Gruppen in multilingualen Situationen als Kommunikationsmittel (vgl. Lewandowski 1994, 816).
Erbe der Kolonialzeit
Als immaterielles Erbe der Kolonisation werden Pidgin-Sprachen nicht nur in Papua-Neuguinea, sondern auch in Afrika gesprochen, die auf europäischen Sprachen basieren und „als Fusionsprodukte im Kontakt mit afrikanischen Sprachen entstanden [sind] z. B. Kamerun-Pidgin oder Wes Cos, Krio, Crioulo oder Portugirsisch-Kreolisch in Westafrika“ (Haarmann 2002, 129). Darüber hinaus etablierte sich im Laufe der deutschen Kolonialzeit in Namibia (Afrika) ein Pidgin, das ‚Küchendeutsch‘ (auf Englisch ‚Namibian Black German’/ ‚NBG‘) genannt und von ca. 15.000 Menschen gesprochen wird.
Kritik
Obwohl Pidginsprachen für die beteiligten Sprecher von Vorteil sein können, werden sie auch kritisiert. Ein Hauptkritikpunkt an Pidginsprachen ist, dass sie als minderwertig angesehen werden. Da sie im Vergleich zu voll entwickelten Sprachen oft als einfacher und unvollständig angesehen werden, können Pidgin-Sprecher stigmatisiert und diskriminiert werden. Sie haben möglicherweise nicht die gleichen Möglichkeiten in Bereichen wie Bildung, Arbeit oder soziale Integration wie Sprecher der dominanten Sprache. Kritisiert wird auch, dass Pidginsprachen oft eine begrenzte und vereinfachte Grammatik haben. Es wird argumentiert, dass sie nicht in der Lage sind, die komplexen Konzepte und feinen Nuancen einer voll entwickelten Sprache auszudrücken. Dies kann zu Missverständnissen führen und die Kommunikation erschweren. Ein weiterer Kritikpunkt ist die Gefahr des Sprachverlusts. Pidginsprachen können entstehen, wenn Menschen mit unterschiedlichen Sprachen aufeinandertreffen und eine gemeinsame Kommunikation finden müssen. Wenn jedoch der Kontakt zur eigenen Sprachgemeinschaft erhalten bleibt und eine voll entwickelte Sprache erlernt wird, kann der Gebrauch der Pidginsprache im Laufe der Generationen abnehmen. Dies kann zum Verlust des sprachlichen Erbes und der kulturellen Identität führen.
Darüber hinaus wird argumentiert, dass Pidginsprachen als eine Form des linguistischen Imperialismus betrachtet werden können. Insbesondere in kolonialen Kontexten wurden Pidgin-Sprachen oft als Mittel der Kontrolle und Unterdrückung eingesetzt, um die ursprünglichen Sprachen der indigenen Bevölkerung zu verdrängen. Dies kann zu weiterer Marginalisierung und Unterdrückung führen.
*Eine Kreolsprache ist eine natürliche Sprache, die aus der Vermischung verschiedener Sprachen entstanden ist. Sie entwickeln sich vor allem in mehrsprachigen Gesellschaften, in denen verschiedene Sprachen auf engem Raum miteinander in Kontakt kommen, wie z.B. in Kolonien oder Handelszentren. Eine Kreolsprache entsteht, wenn Menschen mit unterschiedlichen Muttersprachen eine gemeinsame Kommunikationsbasis benötigen und Elemente ihrer jeweiligen Sprachen vermischen. Kreolsprachen weisen oft eine Mischung von Wörtern, grammatikalischen Strukturen und Lautsystemen verschiedener Ursprungssprachen auf. Ihre Struktur kann eine Vereinfachung oder Reduktion der Ursprungssprachen aufweisen, um die Verständigung zwischen den Sprechern zu erleichtern. Im Laufe der Zeit entwickeln Kreolsprachen jedoch ihre eigene Grammatik und ihren eigenen Wortschatz, die sich von denen der Ursprungssprachen unterscheiden können. Kreolsprachen sind oft mit bestimmten Regionen oder ethnischen Gruppen verbunden und können verschiedene Funktionen erfüllen, wie die Kommunikation innerhalb enger Gemeinschaften, die Bewahrung des kulturellen Erbes oder als Symbol der nationalen Identität. Sie sind Ausdruck kultureller Vielfalt und ein wichtiger Teil des kulturellen Erbes vieler Gesellschaften.
Hier geht es zum Überblick aller Lexikonartikel…
Literatur
Bußmann, H. (Hrsg.) (2002): Lexikon der Sprachwissenschaft. 3. Aufl. Stuttgart: Kröner.
Haarmann, H. (2002): Sprachenalmanach. Zahlen und Fakten zu allen Sprachen der Welt. Frankfurt: Campus.
Heine, Matthias (2016): Wie die Kinder von Neuprommern eine Sprache erfanden. https://www.welt.de/kultur/article153927764/Wie-Kinder-aus-Neupommern-eine-Sprache-erfanden.html [17.12.2019].
Lewandowski, T. (1994): Linguistisches Wörterbuch. 2. Aufl. Wiesbaden: Quelle & Meyer.
Struktur und Geschichte des Niederländischen :: Niederländische Philologie FU Berlin (fu-berlin.de)
Eine wahre interkulturelle Begebenheit wird in dem Buch von Benjamin Haag geschildert:
Raste und faste
Für meine Rückreise von Malaysia/Indonesien hatte ich einen Zwischenstopp in Dubai eingeplant. Der Aufenthalt sollte ca. 15 Stunden dauern. Ich wusste, dass zu diesem Zeitpunkt Ramadan war. In Malaysia war das relativ unproblematisch für mich als Touristin. Das einzige, was ich als ein wenig einschränkend empfand, war, dass während längerer Busfahrten nach Sonnenuntergang immer eine sehr lange Pause eingelegt wurde, damit die Reisenden und der Busfahrer essen konnten. Die Pausen wurden nicht in die Gesamtdauer der Busfahrt eingerechnet und man kam sehr oft Stunden später an als geplant, aber das war für mich eigentlich kein Problem. In Dubai allerdings fühlte ich mich in meinen Rechten stark beschränkt. Als wir den Flughafen verließen und den Metrobereich betraten, fielen schon die Broschüren auf, die darüber informierten, wie man sich in der Metro zu verhalten habe, was man dürfe und was nicht und wie hoch die Strafen bei Nichtbeachtung der Regeln seien.
Irgendwann landeten wir in der Dubai Mall, was eigentlich erfreulich sein sollte, da wir langsam Durst und Hunger bekamen. Doch die Aushänge in der Mall verhießen nichts Gutes: „Dear Visitors, in respect of the holy month of Ramadan, the consumption of food and beverages until sunset is prohibited by LAW within the premises of The Dubai Mall.“ Sollte das bedeuten, dass ich auch nichts trinken durfte? Ich als westlicher Tourist? Wir sondierten weiter die Lage und dachten zunächst, dass diese Regeln nur für die Mall gelten würden. Also überlegten wir uns, einfach etwas zu essen und zu trinken zu kaufen, um uns dann draußen damit hinzusetzen. Wir gingen zum Foodcourt, wo alle Stände und Läden auf den ersten Blick geschlossen wirkten. Bei genauerem Hinsehen bemerkten wir, dass einige Läden geöffnet waren, nur das Essen komplett verdeckt war. Wir gingen zu einem Sandwichladen und fragten, ob wir was bestellen könnten. Wir konnten.
Als wir dann bezahlten fragte ich, wo denn der nächste Ausgang aus der Mall sei und wo man sich draußen hinsetzen könne, um zu essen. Daraufhin schaute mich die Angestellte sehr verwirrt an. Man dürfe nirgendwo essen und trinken. So schaute ich verwirrt. Nirgendwo? Daraufhin erklärte sie mir, dass der einzige Ort, an dem man essen könne, die eigene Unterkunft, also das Hotel sei. Ich erklärte, dass ich eine Tagestouristin sei und keine Unterkunft hätte. Sie konnte mir nicht weiterhelfen. Ich fragte noch eine andere Person, da ich das kaum glauben konnte, aber auch diese bestätigte die Aussage.
Also entschlossen wir uns, nach draußen zu gehen und in einer geheimen Ecke unser Essen und Trinken herunterzuschlingen. Dabei bedachten wir nicht, dass es in der Retorte Dubai schwierig war, eine geheime Ecke zu finden. Bei über 40 Grad saßen wir dann irgendwann auf einer Bank, einer schaute nach links, der andere nach rechts (eine hohe Geldstrafe wollten wir schließlich vermeiden) und begannen, aus unseren Rucksäcken zu essen und zu trinken. Dabei beobachteten wir die Bauarbeiter, die bei sengender Hitze auf der Baustelle schufteten und bestimmt auch nichts trinken durften.
