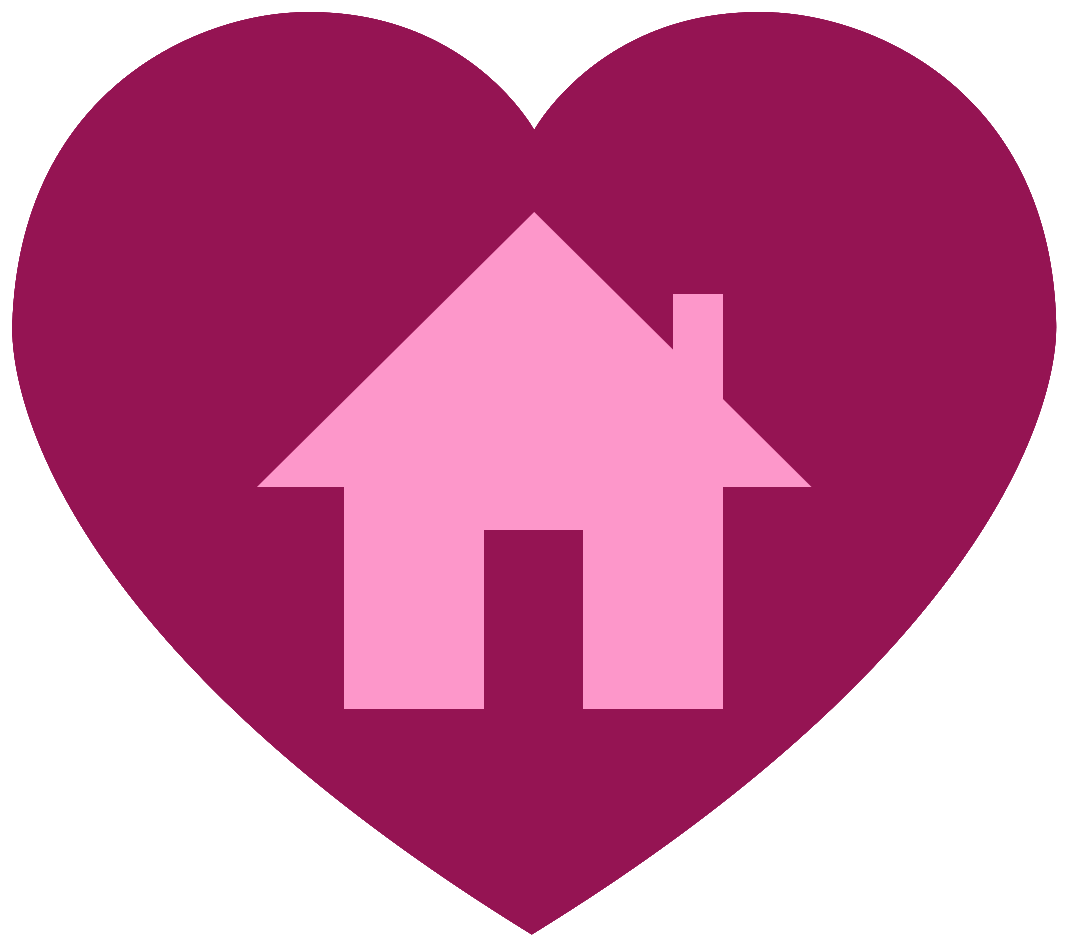
Die Heimat bildet „ein schillerndes, kulturelles Phänomen, das Bedeutungsschichten aus vielen Jahrhunderten transportiert“ (Kazal 2005, 61). Der Begriff ist aufgrund seiner Verwendung komplex konnotiert (vgl. Kühne/ Schönwald 2015, 101–104). Er entwickelte sich aus dem althochdeutschen Wort heimuoti und steht als „Land, Landesteil oder Ort, in dem man [geboren und] aufgewachsen ist oder sich durch ständigen Aufenthalt zu Hause fühlt“ (Duden online) für die Relation zwischen Mensch und einem territorialen Gebiet bzw. den dort vorherrschenden Werten und Normen (vgl. Kühne/ Schönwald 2015, 101–106).
Zur historischen Entwicklung des Begriffs
Bezogen auf den historischen Kontext hat sich für Kühne und Schönwald „Heimat, insbesondere im Rückblick auf das 20. Jahrhundert, keinesfalls als harmloses Konzept erwiesen“ (Kühne/ Schönwald 2015, 104). Lobensommer führt diesbezüglich an, dass die Verwendung des Begriffs „zwischen 1945 und Mitte der Siebziger in der Unterhaltungsliteratur in erster Linie im Sinne einer nostalgischen Erinnerung, einer unerreichbaren Utopie erfolgte, die auf politische Konnotationen verzichtet habe“ (Lobensommer 2010, 75–76). Er verweist hierbei auf Autoren wie Siegfried Lenz und Günter Grass (vgl. Lobensommer 2010, 75–76).
Die bis 1959 sehr eng gefasste Definition von Heimat in Bezug auf einen lokalen Raum sowie die dort vorherrschenden Ansichten und Traditionen wurde durch die Umschreibung auch mehrerer Orte oder größerer Gebiete abgelöst (vgl. Lobensommer 2010, 75). Diese Entwicklung des Loslösens von einem stark eingrenzenden Heimatbegriff setzte sich stetig fort. Nach Pazarkaya wird im Jahr 1986 „Heimat in sich selbst […] [gefunden], wodurch es zu einer Verinnerlichung von Heimat, einer Subjektivierung kommt, die durch den Erwerb von Freunden, positiven Gefühlen, ständig neue Heimaten kreieren kann“ (Lobensommer 2010, 79).
Heimat in einer globalisierten Welt
In der heutigen Zeit erfährt der Heimatbegriff im Kontext der sich immer stärker ausprägenden Globalisierung und der damit einhergehenden „Dezentrierung der Lebenswelten vieler Menschen“ (Kühne/ Schönwald 2015, 101–106) eine Renaissance hinsichtlich des Wunsches einer „Rückverortung“ (Kühne/ Schönwald 2015, 101–106) in eine vertraute Lebenswelt. Dabei findet der Ausdruck oftmals als Synonym für eine „regionale Identität“ (Kühne/ Schönwald 2015, 101–106) Verwendung. Diese spiegelt sich u. a. in der sozialen Dimension in Form von Familie und Freundeskreis mit einem „unhinterfragt akzeptierten Set an Rollen-, Wert- und Normvorstellungen“ (Kühne/ Schönwald 2015, 101–106) wider, welches in vielen Fällen zugleich die Dimension der Ab- und Ausgrenzung anderer Personen und/ oder Kulturen zur Folge hat.
Weitere Aspekte in diesem Zusammenhang bilden die Zeit („romantisierende Rückbesinnung auf die eigene Vergangenheit“) (Kühne/ Schönwald 2015, 101–106) sowie die Dimensionen des Ortes in Form der „Landschaft als Natur- und Kulturlandschaft“ (Schreiber 2012, 3) und der „Entkomplexisierung“ (Kühne/ Schönwald 2015, 101–106).
Heimat und Migration
Vor dem Hintergrund der Migration bildet der Heimatbegriff Anlass für eine kontrovers geführte (Heimat-)Debatte, da viele ‚einheimische‘ Menschen einen Kultur- und damit einen Machtverlust ihres Wertekorsetts befürchten (vgl. Kühne/ Schönwald 2015, 101–106). Sie definieren die vermeintlich ‚richtige‘ Kultur und damit die Zugehörigkeit zur Gesellschaft über „den ‚richtigen’ Dialekt, die ‚richtige’ ethnische Zugehörigkeit (dokumentiert durch die Ortsansässigkeit der Vorfahren), Heterosexualität, die ‚richtige’ Religion sowie die Praxis lokaler und regionaler Traditionen (nicht das kognitive Wissen darüber!)“ (Kühne/ Schönwald 2015, 101–106).
Heimatlosigkeit
Das Gefühl von Heimatlosigkeit bezieht sich auf den Mangel an einem Ort, einer Gemeinschaft oder einer kulturellen Identität, die als tief mit dem individuellen und emotionalen Wohlbefinden verbunden empfunden wird. Es ist ein Zustand der inneren Unruhe, in dem sich eine Person entwurzelt, isoliert und alleine fühlt. Menschen können sich heimatlos fühlen, wenn sie gezwungen sind, ihre Heimat zu verlassen, sei es aufgrund politischer Gründe, Krieg, Naturkatastrophen oder wirtschaftlicher Schwierigkeiten. In solchen Fällen wird der Bezugspunkt für Sicherheit und Zugehörigkeit abrupt entfernt, was zu einem Gefühl des Verlustes und des Fremdseins führt.
Die selbstbestimmte Identität kann ebenfalls ein Grund für Heimatlosigkeit sein. Menschen, die ihre kulturelle oder ethnische Identität nicht überzeugend mit ihrer Heimat oder Gemeinschaft verbinden können, können sich ebenfalls heimatlos fühlen. Zum Beispiel könnte eine Person mit einer gemischten kulturellen oder ethnischen Hintergrund sich zwischen den verschiedenen kulturellen Identitäten hin- und hergerissen fühlen, was dazu führt, dass sie sich nirgendwo richtig zugehörig fühlt. Das Gefühl der Heimatlosigkeit kann zu verschiedenen emotionalen und psychologischen Herausforderungen führen. Es kann zu Angst, Depression, Einsamkeit und Identitätskrisen führen. Menschen können auch Schwierigkeiten haben, ihr Leben zu organisieren und eine stabile Zukunft zu planen, da ihnen ein zuverlässiger Rahmen für ihr Leben fehlt. Insgesamt ist das Gefühl von Heimatlosigkeit ein komplexer Zustand, der tiefgreifende emotionale Auswirkungen haben kann.
Ein Beispiel dafür kann die Geschichte vieler Russlanddeutschen sein. Sie sind Nachkommen von Deutschen, die ab dem 18. Jahrhundert nach Russland ausgewandert sind und dort über Jahrhunderte gelebt haben. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion in den 1990er Jahren kehrten viele ihrer Nachkommen nach Deutschland zurück, um ihre deutsche Staatsbürgerschaft anzunehmen und ihre kulturelle Identität zu erforschen. Für Russlanddeutsche kann sich das Gefühl von Heimatlosigkeit auf verschiedenen Ebenen manifestieren. Zunächst einmal gibt es oft eine kulturelle Entfremdung. Nach Jahrhunderten in Russland haben Russlanddeutsche oft ihre deutsche Sprache und ihre traditionsreiche deutsche Kultur bewahrt. Jedoch sind sie dennoch in der russischen Kultur sozialisiert worden und haben somit eine Art „doppelte Identität“. Bei ihrer Rückkehr nach Deutschland stoßen sie manchmal auf Vorurteile und Unverständnis, da sie aufgrund ihrer Kultur und Sprache als „fremd“ wahrgenommen werden. Sie fühlen sich oft zwischen den beiden Kulturen hin- und hergerissen und können sich in beiden Welten nicht vollständig zuhause fühlen. Des Weiteren kann das Gefühl der Heimatlosigkeit auch daraus resultieren, dass Russlanddeutsche häufig in sozialen, wirtschaftlichen oder politischen Unsicherheiten leben. Nach der Rückkehr nach Deutschland stehen sie oft vor Herausforderungen wie der Suche nach Arbeit, der Integration in die Gesellschaft und der Bewältigung von Sprachbarrieren. Viele Russlanddeutsche empfinden es als schwierig, sich in Deutschland zurechtzufinden und eine neue Heimat zu finden, da sie mit diesen Herausforderungen konfrontiert werden. Die Heimatlosigkeit kann auch durch die gesellschaftliche Stigmatisierung in Deutschland verstärkt werden. Vorurteile und Stereotype über Russlanddeutsche können zu einer Marginalisierung führen und den Prozess der Integration erschweren. Diese erlebte Diskriminierung verstärkt das Gefühl der Nicht-Zugehörigkeit und verstärkt das Gefühl, keine Heimat zu haben.
Hier geht es zum Überblick aller Lexikonartikel…
Literatur
Dudenredaktion (o. J.): „Heimat“ auf Duden online. https://www.duden.de/rechtschreibung/Heimat [25.06.2018].
Kazal, Irene (2005): „Sozialistische Heimat DDR“. Landschaft, Nation und Klasse in der Heimatdebatte der 50er Jahre. In: Kazal, I./ Voigt, A./ Weil, A./ Zutz, A. (Hrsg.): Kulturen der Landschaft. Ideen von Kulturlandschaft zwischen Tradition und Modernisierung. Berlin, 59–80.
Kühne, Olaf/ Schönwald, Antje: Identität, Heimat sowie In- und Exklusion: Aspekte der sozialen Konstruktion von Eigenem und Fremdem als Herausforderung des Migrationszeitalters. https://www.econstor.eu/bitstream/10419/111036/1/ab_013_08.pdf [25.6.2018].
Lobensommer, Andrea (2010): Die Suche nach Heimat. Heimatkonzeptionsversuche in Prosatexten zwischen 1989 und 2001. München: Diss. masch.
Schreiber, Wilfried E. (2012): Heimat verorten: Heimat aus der Sicht eines Geographen – In: Neue Didaktik 1, S. 1-6. https://www.pedocs.de/volltexte/2015/10068/pdf/NeueDidaktik_1_2012_Schreiber_Heimat_verorten.pdf [25.06.2018].
 Drucke diesen Beitrag
Drucke diesen Beitrag
Info 03.05 Was ist Heimat?- Definitionen | Jugendliche zwischen Ausgrenzung und Integration | bpb.de
Transkript zum Erklärfilm
Der Heimat-Begriff wurde bis 1959 sehr eng als ein lokaler Raum mit den dort vorherrschenden Ansichten und Traditionen definiert. Inzwischen umschreibt das Heimatkonzept auch mehrere Orte oder größere Gebiete. In der heutigen Zeit erfährt der Heimatbegriff eine Renaissance: Aufgrund der Globalisierung nimmt die Komplexität der Lebenswelt zu, weshalb sich viele Menschen eine vertraute, klar eingegrenzte Umgebung wünschen, in der ein festes Set von Werten und Normen gilt. Deshalb wird der Ausdruck derzeit oft als Synonym für eine regionale Identität verwendet. Dies hat in vielen Fällen eine Ausgrenzung anderer Personen oder Kulturen zur Folge.
Eine wahre interkulturelle Begebenheit wird in dem Buch geschildert:
Trinkgeld = Beleidigung
Ich habe mit meinem Freund in China viel erlebt. An einem besonders heißen Tag wollten wir mit unserer Reisegruppe den West-Lake in der Nähe von Hangzhou besuchen und mieteten einen kleinen Reisebus. Als wir schließlich nach einer sehr holprigen Fahrt den Bus verlassen konnten, wollten wir dem Busfahrer, der schließlich auf uns wartete, eine Packung Zigaretten hinterlassen.
Wir wussten, in China wird Trinkgeld nicht gut angesehen. Die Chinesen fühlen sich sogar in ihrer Ehre gekränkt, da das Trinkgeld dem einfachen Bürger zeigt „Du verdienst zu wenig Geld. Hier, damit du dir auch einmal etwas leisten kannst“.
Darum dachten wir, weil in China sowieso fast jeder Mann raucht, lassen wir ihm ein paar Zigaretten da. Der Busfahrer sah die Zigaretten in seinem Bus liegen, rief uns zu und gab uns die Packung mit ernster Miene zurück. Als wir ihm dann erklären konnten, dass die Zigaretten ein Geschenk von uns für ihn seien, zog er ab und schenkte die Schachtel einem Obdachlosen, der am Busparkplatz auf dem Boden saß. Bei unserer Rückkehr zum Bus schaute uns der Busfahrer mit komischem Blick an. Seine Stimmung uns gegenüber hatte sich verschlechtert.
