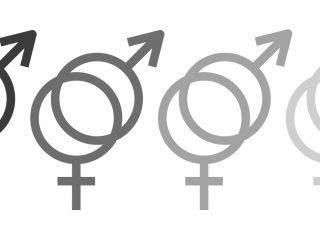In geschlechterreflektiertem Verhalten und Kommunizieren liegt oft die Problematik, dass auf der einen Seite die gesellschaftlich konstruierte Kategorie des Geschlechts aufgelöst werden soll, um die Individualität von Menschen zu unterstützen. Auf der anderen Seite muss jedoch das Geschlecht häufig erst thematisiert werden, um soziale Unterschiede zu verdeutlichen. Um mit dieser Ambivalenz richtig umzugehen, muss eine Ausgewogenheit zwischen Dramatisierung und Entdramatisierung von Geschlecht entstehen.
Dramatisierung
Bei der Dramatisierung werden explizit Genderaspekte hervorgehoben. Problematisch ist hierbei, dass Geschlechtergruppen dichotomisiert werden und Differenzen innerhalb der Geschlechtergruppen untergehen, was eine Manifestierung von Geschlechterstereotypen zur Folge haben kann. Wenn eine Geschlechterrolle zunächst konstruiert bzw. visualisiert wird, um sie daraufhin wieder zu dekonstruieren, besteht die Gefahr einer stärkeren Einprägung der traditionellen Geschlechterrolle. Dementsprechend ist ein differenzierter und genauer Umgang mit dem jeweiligen Genderbezug notwendig. Sinnvoll ist eine Dramatisierung, wenn das Gegenüber angeregt werden soll, über Geschlechterverhältnisse nachzudenken. Vor allem in Situationen, in denen es zu geschlechtsspezifischer Diskriminierung oder zur Verhinderung der Entwicklung individueller Vielfalt kommt, ist eine Dramatisierung von Geschlecht angemessen. Ein Beispiel für die Dramatisierung von Geschlechtern in den Medien wäre die Darstellung von Frauen als emotionale, passive Wesen, die sich vor allem um ihr Aussehen und ihre Beziehungen kümmern, während Männer als rational, aktiv und karriereorientiert dargestellt werden. Dies führt zu einer Verfestigung von Geschlechterstereotypen und kann dazu beitragen, dass bestimmte Verhaltensweisen, Interessen oder Berufswahl als „typisch männlich“ oder „typisch weiblich“ wahrgenommen werden.
Die Dramatisierung von Geschlechtern hat Auswirkungen auf die Gesellschaft, da sie die sozialen Erwartungen und Normen in Bezug auf Geschlechterrollen und -identitäten weiter festigt. Sie trägt dazu bei, dass Menschen, die nicht den stereotypen Geschlechterverhalten entsprechen, stigmatisiert, diskriminiert oder unsichtbar gemacht werden.
Um ein Bewusstsein für die Vielfalt von Geschlechteridentitäten und -ausdrucksformen zu schaffen und stereotype Rollenbilder aufzubrechen, sollte die Dramatisierung von Geschlechtern erkannt und hinterfragt werden.
Entdramatisierung
Die Entdramatisierung von Geschlechtern bezieht sich auf den Prozess der Verringerung der Bedeutung, die Geschlechterrollen und Geschlechtsunterschiede in der Gesellschaft haben. Es geht darum, Stereotypen und Vorurteile in Bezug auf Geschlecht abzubauen und stattdessen ein Verständnis für die Vielfalt und Komplexität von Geschlecht zu fördern. Es wird darauf abgezielt, starre Geschlechterrollen aufzubrechen, die Menschen in enge Kategorien zwängen und bestimmte Erwartungen und Verhaltensweisen aufgrund ihres Geschlechts auferlegen. Dies kann dazu führen, dass Menschen sich eingeschränkt fühlen und Schwierigkeiten haben, ihre Persönlichkeit und Interessen authentisch auszudrücken.
Geschlechtsbezogene Zuschreibungen oder Besonderheiten werden vermieden, allerdings ohne zu neutralisieren. Die Entdramatisierung dient der Bewusstmachung weiterer Kategorien, die Menschen auf individueller oder gesellschaftlicher Ebene voneinander unterscheiden und die nicht mit dem konstruierten Geschlecht in Verbindung stehen. Sinnvoll zu verwenden ist die Entdramatisierung als Folge oder Reaktion auf eine geschlechterdramatisierende Situation, um diese zu relativieren. Dies kann beispielsweise Anwendung finden, wenn das Gegenüber regelmäßig Geschlechterunterschiede hervorhebt, indem Frauen oder Männern bestimmte Eigenschaften oder Fähigkeiten zugeschrieben werden.
Indem Geschlechterrollen entdramatisiert werden, sollen Menschen unabhängig von ihrem Geschlecht die Freiheit haben, ihre Identität und ihr Leben nach ihren eigenen Vorlieben zu gestalten. Es geht darum, ein Umfeld zu schaffen, das Vielfalt und Gleichberechtigung ermöglicht, indem Diskriminierung aufgrund des Geschlechts beseitigt wird.
Ein wichtiger Aspekt der Entdramatisierung von Geschlechtern ist die Anerkennung von Gender als sozial konstruiertem Phänomen. Geschlechter werden nicht mehr als reine biologische Tatsache betrachtet, sondern als Ergebnis sozialer und kultureller Prozesse, die in verschiedenen Gesellschaften unterschiedlich sein können. Es wird erkannt, dass Geschlechteridentität und Geschlechtsausdruck individuell sind und nicht auf eine binäre Kategorisierung von männlich und weiblich beschränkt sein müssen.
Die Entdramatisierung von Geschlechtern hat das Potenzial, die Geschlechtergerechtigkeit und inklusive Gesellschaften voranzutreiben. Es wird jedoch auch kritisiert, dass diese dazu führt, dass Geschlecht als irrelevant angesehen wird. Diese Sichtweise blendet nämlich aus, dass Geschlecht eine wichtige Rolle im Leben eines Menschen spielt und Auswirkungen auf soziale, kulturelle und politische Bereiche hat. Indem Geschlecht als nebensächlich betrachtet wird, werden Diskriminierungserfahrungen von Menschen aufgrund ihres Geschlechts nicht angemessen beachtet oder anerkannt. Eine weitere Kritik betrifft die Gefahr der Unsichtbarmachung von Geschlechtsunterschieden. Indem Geschlecht entdramatisiert wird, können bestehende gesellschaftliche Ungleichheiten und strukturelle Benachteiligungen verschleiert werden. Geschlechterstereotype und -rollen können auf diese Weise weiterhin wirksam sein und Veränderungen werden erschwert.
Hier geht es zum Überblick aller Lexikonartikel…
Literatur
Debus, Katharina (2012): Dramatisierung, Entdramatisierung und Nicht-Dramatisierung in der geschlechterreflektierten Bildung. In: Debus, Katharina/ Könnecke, Bernard/ Schwerma, Klaus/ Stuve, Olaf (Hrsg.): Geschlechterreflektierte Arbeit mit Jungen an der Schule. Texte zu Pädagogik und Fortbildung rund um Jungenarbeit, Geschlecht und Bildung. Berlin: Dissens e. V., 149–158.
Frohn, Judith/ Süßenbach, Jessica (2012): Geschlechtersensibler Schulsport. Den unterschiedlichen Bedürfnissen von Mädchen und Jungen im Sport mit Genderkompetenz begegnen. In: Sportpädagogik. Zeitschrift für Sport, Spiel und Bewegungserziehung 6/2012, 2–7.
Transkript zum Erklärfilm
Im Diskurs um Geschlechterungleichheiten wird zum einen gefordert, die Kategorie des Geschlechts aufzulösen, sodass die Individualität von Menschen im Vordergrund steht. Zum anderen muss jedoch das Geschlecht häufig erst thematisiert werden, damit soziale Unterschiede verdeutlicht werden können. Es muss also eine Ausgewogenheit zwischen der Dramatisierung und Entdramatisierung von Geschlecht hergestellt werden, um dem Thema Geschlecht gerecht zu werden. Bei der Dramatisierung werden Genderaspekte hervorgehoben. Sinnvoll ist eine Dramatisierung, wenn das Gegenüber über Geschlechterverhältnisse nachdenken soll. Problematisch ist allerdings, dass dabei Differenzen innerhalb der Geschlechtergruppen untergehen. Dies kann Geschlechterstereotype verstärken. Bei der Entdramatisierung werden geschlechtsbezogene Zuschreibungen vermieden. Sie dient der Bewusstmachung geschlechtsunabhängiger Kategorien, die Menschen auf individueller oder gesellschaftlicher Ebene voneinander unterscheiden. Sinnvoll ist die Entdramatisierung als Reaktion auf eine geschlechterdramatisierende Situation, um diese zu relativieren.
Eine wahre interkulturelle Begebenheit wird in dem Buch von Benjamin Haag geschildert:
Der Affe oder ich!
Als ich noch klein war, reisten meine Eltern und ich regelmäßig an die Elfenbeinküste, in die Heimat meines Vaters, um meine große Familie dort zu besuchen. Ein sehr enger Freund meiner Eltern begleitete uns manchmal. Um die folgende Geschichte zu verstehen, ist es hilfreich, zu wissen, dass er Vegetarier ist.
Der Freund meiner Eltern war an diesem Tag allein zu Hause. Er bekam Hunger und ging zum Kühlschrank, um sich etwas zu Essen zu holen. Kaum hatte er die Tür geöffnet, ließ er sie hastig wieder zu fallen. Der Schreck war ihm in alle Glieder gefahren – denn im Kühlschrank steckte ein nacktes, totes Baby!
Völlig aufgelöst erzählte er meinem Vater von seinem Fund. Es stellte sich heraus, dass es sich um einen toten Affen handelte, den mein Vater tags zuvor von einem Jäger geschenkt bekommen hatte. Da ihm bereits das Fell abgezogen worden war, ähnelte er einem Säugling.
Affenfleisch gilt an der Elfenbeinküste als Delikatesse und es war eine ganz besondere Aufmerksamkeit und Ehrerbietigkeitsbekundung des Jägers meinem Vater gegenüber, ihm das erlegte Tier zu schenken. Meine Tante brannte darauf, diese Rarität für die Familie zuzubereiten. Für den Freund meiner Eltern aber war es einfach nur abstoßend, dieses Tier im Ganzen im Kühlschrank zu haben, vor allem wegen des ersten Schocks, den er bei seinem Anblick erlebt hatte. Überhaupt hielt er es für barbarisch, Affen zu essen, vor allen anderen Tieren, weil sie dem Menschen so ähnlich sind.
Für ihn stand fest: der Affe oder ich! Er war bereit, den nächsten Flieger zu nehmen, sollte das Tier nicht umgehend aus dem Kühlschrank verschwinden. Mein Vater redete mit Engelszungen auf ihn ein, doch es half alles nichts: sie mussten das „gute Fleisch“ weiter verschenken, um den Freund zu besänftigen.
Falscher Patriotismus oder ewige Schuld
Im Sommer 2014 besuchte ich mit meiner Schwester meine Gastfamilie in London. Wir schauten uns ein Fußballspiel der WM an und feuerten die deutsche Mannschaft an. Meine Gastmutter ist jüdischer Herkunft und fragte uns, ob wir überhaupt etwas über den Holocaust wissen. Nachdem ich ihr erklärte, dass wir darüber aufgeklärt sind, fragte sie, warum wir dann unser Land anfeuern.