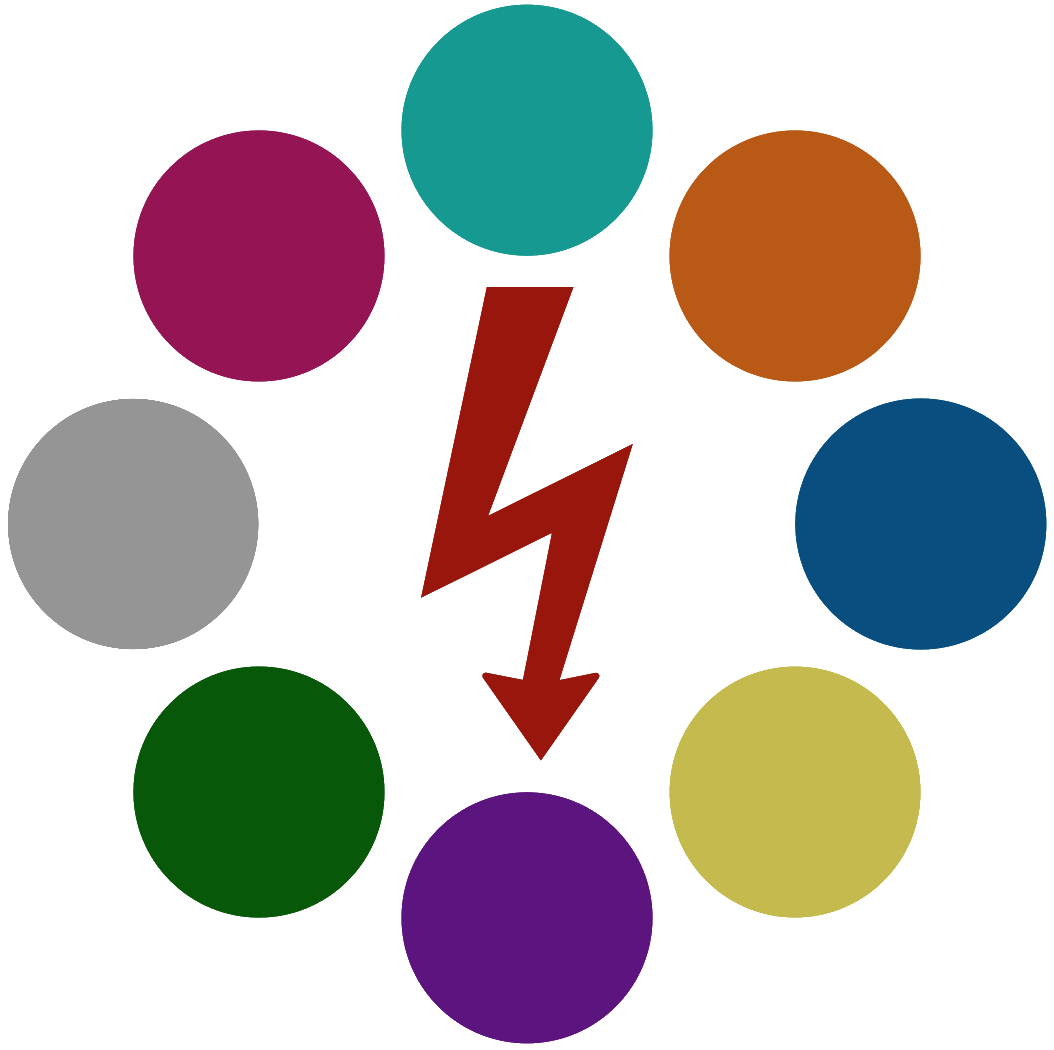 Der Begriff Kampf der Kulturen (amerik. The Clash of Civilizations) geht auf einen Artikel des US-amerikanischen Politikwissenschaftlers und Soziologen Samuel P. Huntington* zurück. Im Jahr 1993 erschien der Beitrag mit dem fragenden Titel The Clash of Civilizations? in der Zeitschrift Foreign Affairs. Drei Jahre später wurde das gleichnamige Werk Kampf der Kulturen. Die Neugestaltung der Weltpolitik im 21. Jahrhundert publiziert und löste im Folgenden international kontroverse Debatten aus. Huntington ist der Meinung, dass die Ursache zukünftiger Konflikte nicht mehr ideologischer oder ökonomischer Natur, sondern im Zusammenprall von Zivilisationen zu finden sein werde (vgl. Caglar 1997).
Der Begriff Kampf der Kulturen (amerik. The Clash of Civilizations) geht auf einen Artikel des US-amerikanischen Politikwissenschaftlers und Soziologen Samuel P. Huntington* zurück. Im Jahr 1993 erschien der Beitrag mit dem fragenden Titel The Clash of Civilizations? in der Zeitschrift Foreign Affairs. Drei Jahre später wurde das gleichnamige Werk Kampf der Kulturen. Die Neugestaltung der Weltpolitik im 21. Jahrhundert publiziert und löste im Folgenden international kontroverse Debatten aus. Huntington ist der Meinung, dass die Ursache zukünftiger Konflikte nicht mehr ideologischer oder ökonomischer Natur, sondern im Zusammenprall von Zivilisationen zu finden sein werde (vgl. Caglar 1997).
8 Kulturkreise
Der Identifikationszusammenhang wird dabei durch Kulturkreise oder Zivilisationen gebildet, die Huntington wie folgt bezeichnet: „definiert sich sowohl durch gemeinsame objektive Elemente wie Sprache, Geschichte, Religion, Sitten, Institutionen als auch durch die subjektive Identifikation der Menschen mit ihr.“ (Huntington 1996, 28) Durch Forschungen von Historikern und Völkerkundlern teilt Huntington die Welt in acht Kulturkreise beziehungsweise Zivilisationen ein (vgl. Huntington 1996, 28). Die identifizierten Kulturkreise sind:
- Westlicher Kulturkreis: Dieser Kulturkreis umfasst im Wesentlichen Nordamerika und Westeuropa sowie andere Teile der Welt, die von westlichen Werten und Ideen wie Demokratie, Individualismus und Säkularismus beeinflusst sind.
- Lateinamerikanische Kultur: Der lateinamerikanische Kulturkreis umfasst die spanisch- und portugiesischsprachigen Länder Mittel- und Südamerikas sowie der Karibik. Gemeinsame kulturelle Merkmale sind die lateinamerikanische Sprache, der katholische Glaube und eine historische Verbindung zu den europäischen Kolonialmächten.
- Afrikanische Kultur: Dieser Kulturkreis umfasst den afrikanischen Kontinent und die afrikanische Diaspora weltweit, insbesondere in Nordamerika und der Karibik. Gemeinsame kulturelle Merkmale sind eine Vielfalt ethnischer Gruppen, religiöse und spirituelle Praktiken sowie eine reiche mündliche Überlieferung.
- Islamischer Kulturkreis: Der islamische Kulturkreis umfasst vor allem Länder mit muslimischer Mehrheitsbevölkerung in Nordafrika, dem Nahen Osten, Zentralasien und Teilen Südostasiens. Der Islam als Religion spielt eine wichtige Rolle in der Kultur dieser Länder, mit gemeinsamen Werten wie der Scharia und dem Vorrang der Gemeinschaft vor dem Individuum.
- Slawisch-orthodoxe Kultur: Dieser Kulturkreis umfasst die Länder Osteuropas, die Teil der ehemaligen Sowjetunion waren, sowie Teile des Balkans. Die slawisch-orthodoxe Kultur ist vom russischen und byzantinischen Erbe sowie vom orthodoxen Christentum geprägt.
- Konfuzianische Kultur: Dieser Kulturkreis umfasst vor allem China, Japan, Korea und Vietnam. Die konfuzianische Kultur basiert auf den Lehren des chinesischen Philosophen Konfuzius und zeichnet sich durch die Betonung von Tradition, Hierarchie und Familienwerten aus.
- Indische Kultur: Die indische Kultur umfasst Indien, Nepal, Sri Lanka und Bhutan. Hinduismus und Buddhismus haben hier eine große kulturelle und religiöse Bedeutung, ebenso das Kastensystem und die indische Philosophie.
- Westlich-orthodoxe Kultur: Dieser Kulturkreis umfasst vor allem osteuropäische Länder, die dem orthodoxen Christentum angehören, wie Russland, die Ukraine und Griechenland. Die Traditionen und Werte der osteuropäischen orthodoxen Kirchen sind integraler Bestandteil dieser Kultur. (vgl. Huntington 1996, 40)
The Clash of Civilizations
Mit einem Verweis auf die Tatsache, dass kulturelle Differenzen zu den längsten und blutigsten Konflikten in der Geschichte geführt haben (vgl. Metzinger 2000, 18), stellt Huntington seine zentrale These vor: „Nationalstaaten werden zwar die mächtigsten Akteure auf dem Globus bleiben, die grundsätzlichen Konflikte der Weltpolitik aber werden zwischen Nationen und Gruppierungen aus unterschiedlichen Kulturen auftreten. Der Zusammenprall der Zivilisationen, der Kulturen (civilizations), wird die Weltpolitik beherrschen.“ (Huntington 1993, 1)
Das Überleben des Westens in dieser definierten multipolaren und multikulturellen Weltordnung hängt laut Huntington von Amerika ab, das sich seiner westlichen Identität wieder bewusst werden muss. Wesentlich sei auch die Einsicht der Mitglieder der westlichen Zivilisationen, dass ihre Kultur einzigartig, aber nicht universell ist (vgl. Metzinger 2000, 18). Der Westen sei noch einer der stärksten Kulturkreise, aber seine Macht gehe im Vergleich zu anderen Kulturkreisen zurück (vgl. Huntington 1996, 28).
Weltordnung und Konflikte
Der Westen habe mit inneren Problemen wie Staatsdefiziten oder niedrigem Wirtschaftswachstum zu kämpfen, daher verlagere sich die wirtschaftliche Macht nach Ostasien (vgl. Huntington 1996, 128). Das Gleichgewicht der Kulturen verändere sich, die indische Wirtschaft sitze in den Startlöchern und die islamische Welt stehe dem Westen feindselig gegenüber (vgl. Huntington 1996, 118).
Huntington unterstreicht seine Thesen, indem er die Modernisierung nicht gleichbedeutend mit der Verwestlichung ansieht (vgl. Huntington 1996, 113). Die Modernisierung nicht-westlicher Staaten widersetze sich der Verwestlichung, indem sie ihre eigenen kulturellen Werte in den Vordergrund stelle (vgl. Metzinger 2000, 17).
Die künftige Weltordnung werde durch verschiedene Entwicklungstrends weltpolitisch geprägt sein, weil sie multipolar und multikulturell geworden sei (vgl. Metzinger 2000, 17). Link widerspricht Huntington, indem er konstatiert, dass Differenzen nicht zwangsläufig zu Kriegen führen müssten. Gleichwohl sei eine große Konfliktträchtigkeit zu erwarten (vgl. Link 2001, 38).
*Samuel P. Huntington wurde am 18. April 1927 in New York geboren und wuchs in einer wohlhabenden Familie auf. Schon früh zeigte er großes Interesse an Politik und Gesellschaft, was schließlich zu seiner Karriere als renommierter Soziologe und Politikwissenschaftler führte. Huntington studierte am Harvard College und schloss sein Studium 1946 ab. Anschließend setzte er sein Studium an der University of Chicago fort, wo er sowohl einen Master als auch einen Doktortitel in Politikwissenschaften erwarb. Anschließend lehrte er an verschiedenen Universitäten, darunter die Columbia University und die Harvard University, und wurde zu einem angesehenen Mitglied der akademischen Gemeinschaft. 1968 veröffentlichte Huntington sein bekanntestes Buch „Political Order in Changing Societies“, das ihm den Ruf eines einflussreichen Denkers in der Soziologie einbrachte. In diesem Werk untersuchte er die Herausforderungen, denen sich Gesellschaften bei politischen Veränderungen gegenübersehen, und identifizierte verschiedene Muster und Trends. Das Buch wurde zu einem Standardwerk für Studierende und Fachleute. In den folgenden Jahren setzte Huntington seine Forschungen fort und veröffentlichte eine Reihe weiterer wichtiger Werke. Besonders hervorzuheben ist sein Buch „The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order“ (1996), in dem er prognostiziert, dass politische Konflikte in Zukunft nicht mehr entlang ideologischer Linien, sondern entlang kultureller, religiöser und zivilisatorischer Grenzen ausgetragen werden. Dieser Ansatz wurde kontrovers diskutiert und hatte großen Einfluss auf das Verständnis der internationalen Beziehungen. Neben seiner schriftstellerischen und akademischen Tätigkeit war Huntington auch politisch aktiv. Er war Berater mehrerer US-Präsidenten, darunter Jimmy Carter und Ronald Reagan, und wurde als Analytiker und Stratege geschätzt. Seine konservativen Ansichten und seine Haltung zur amerikanischen Außenpolitik waren jedoch nicht unumstritten. Samuel P. Huntington starb am 24. Dezember 2008 in Martha’s Vineyard, Massachusetts. Sein intellektueller Beitrag zur Soziologie und zur internationalen Politik bleibt jedoch von großer Bedeutung. Mit seinen fundierten Forschungen und klugen Analysen hat er unser Verständnis von politischer Ordnung, sozialer Entwicklung und dem Einfluss von Kultur auf zwischenstaatliche Beziehungen entscheidend erweitert.
Hier geht es zum Überblick aller Lexikonartikel…
Literatur
Gazi, Caglar (1997): Der Mythos vom Krieg der Zivilisationen. Der Westen gegen den Rest der Welt. München: Marino.
Huntington, Samuel Philips (1996): Kampf der Kulturen. Die Neugestaltung der Weltpolitik im 21. Jahrhundert. 5. Aufl. München/ Wien: Europa.
Huntington, Samuel Philips (1993): Im Kampf der Kulturen. https://www.zeit.de/1993/33/im-kampf-der-kulturen [14.06.2018]
Link, Werner (2001): Die Neuordnung der Weltpolitik. Grundprobleme globaler Politik an der Schwelle zum 21. Jahrhundert. 3. Aufl. München: Beck.
Metzinger, Udo M. (2000): Die Huntington-Debatte. Die Auseinandersetzung mit Huntingtons „Clash of civilzations“ in der Publizistik. Köln: SH.
Kampf der Kulturen – Lexikon der Geographie (spektrum.de)
Eine wahre interkulturelle Begebenheit wird in dem Buch geschildert:
Verkehrte Welt
Während meines Chinaurlaubs, den ich mit meiner damaligen Freundin in Hongkong verbrachte, wollten wir den berühmten Clock Tower besuchen. Wir hatten leider ein kleines Problem – die Straßenführung Hongkongs, aufgrund derer wir uns hoffnungslos verlaufen hatten. Zu unserem Glück trafen wir ein Ehepaar mittleren Alters, das bereit war, uns zu helfen, wenngleich sie kein Wort Englisch oder Deutsch sprachen. Mithilfe des Stadtplans wiesen sie uns den Weg – wobei wir bemerkten, dass sie den Stadtplan falsch herum hielten. Trotzdem fanden wir unser gewünschtes Ziel und verbrachten ein paar schöne Tage in Hongkong. Zurück im Hotel sprachen wir mit einem Pagen, der uns verriet, dass nicht-chinesische Stadtpläne die Straßenführung Hongkongs oft auf dem Kopf abbildeten, was auch der Grund dafür war, dass wir uns verlaufen hatten.
Makaber
Die letzte Weltmeisterschaft erlebte ich zusammen mit einem australischen Austauschschüler in Vechta. Für den Abend verabredeten sich die meisten Studierenden zum gemeinsamen public viewing. Natürlich wurde auch der australische Student dazu eingeladen. Als er von der Einladung hörte, wirkte er jedoch schockiert. Der Grund dafür offenbarte sich uns erst im Nachhinein.
Denn public viewing bezeichnet im englischen Sprachgebrauch die öffentliche Aufbahrung eines Toten. Der Austauschschüler konnte sich beim besten Willen nicht vorstellen, dass man sich hierzulande zahlreich zu einer öffentlichen Leichenbeschauung verabredete. So konnte er nur abwarten und war erleichtert, als er letztendlich merkte, dass wir uns lediglich ein Fußballspiel ansahen und dabei Bier tranken.
