Ballroom Culture ist eine Bewegung der US-amerikanischen queeren Szene, die sich in den 1970er und 80er Jahren aus den ursprünglichen ‚Drag Balls‘ (=Travestie-Shows) in New York City entwickelt hat (Vgl. Weems 2008, 88). Die ersten Drag Balls gab es im New Yorker Stadtteil Harlem im späten 19. Jahrhundert (Vgl. Pearlman et al. 2014, 545). Bereits in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts erfreuten sie sich in vielen amerikanischen Großstädten einer zunehmenden Popularität, die bis heute anhält. Einer der Austragungsorte war der weltbekannte Madison Square Garden* in New York City (Vgl. Weems 2008, 86; Vgl. Beemyn 2014, 504). Aufgrund des zunehmenden Konservatismus während und nach dem 2. Weltkrieg wurden diese ursprünglichen Drag Balls verboten, doch die queere Untergrundszene veranstaltete weiterhin Zusammenkünfte dieser Art im privaten Raum, aus denen Ende der 1960er Jahre die Ballroom Culture entstand (Vgl. Weems 2008, 88f.).
Internationale Bekanntheit
In den 1980er und 90er Jahren breitete sich die New Yorker Ballroom Culture auf andere große US-Metropolen aus und erreichte durch Jennie Livingstons Dokumentation Paris Is Burning (1990) sowie Madonnas Hit-Song Vogue (1990) den Mainstream und somit internationale Bekanntheit (Vgl. Beemyn 2014, 514f.). Im Unterschied zu den Drag Balls, welche sich vornehmlich an Schönheitswettbewerben orientieren und primär homosexuellen Männern eine Plattform für ihre Travestiekunst bieten, richtet sich die Ballroom Culture an eine breitere Masse queerer Menschen und bietet insbesondere BlBOC die Möglichkeit, sich in unterschiedlichen Performance-Kategorien zu repräsentieren (Vgl. ebd.; Beemyn, 514f.). Hauptziel dieser Wettbewerbe ist es, sich mit größtmöglicher ‚Realness‘ (Überzeugungskraft) in den jeweiligen Kategorien darzustellen. Dabei wird oftmals mit Gender Subversion gespielt. Bewertet werden die Wettbewerbe durch eine Jury, die zumeist aus respektierten Mitgliedern der Szene besteht (Vgl. Pearlman 2014, 545f.). Teilnehmer*innen laufen dabei einen sogenannten Runway in der gewählten Kategorie und präsentieren sich zumeist im ‚Voguing‘ (Vgl. Weems 208, 88). Die Wettbewerbe im Rahmen der Bälle haben aber auch politische Bedeutung, da die Teilnehmer*innen durch ihren Auftritt die Geschlechterrollen performativ als Konstrukt entlarven (Vgl. Bailey 2011, 366). Auch gehören Parodien und Personifizierungen zum wesentlichen Bestandteil dieser Bälle (Vgl. Pearlman 2014, 545f.). Innerhalb der Ballroom Culture werden (Geschlechts-)Identitätszuschreibungen also als formbar und veränderbar aufgefasst, wodurch sich ihren Mitgliedern die Möglichkeit bietet, sich von heteronormativen Vorstellungen zu befreien und ihre ‚Queerness‘ in einem sicheren Raum auszuleben und zu zelebrieren (Vgl. Bailey 2011, 369f.). Dabei beschränkt sich die Ballroom Culture nicht nur auf das Ausrichten und die Teilnahme an diesen Bällen, sondern bringt ebenso ‚Houses‘ hervor, in denen sich die Teilnehmenden organisieren (Vgl. ebd., 367).
Houses
Die sogenannten ‚Houses‘ bieten Mitgliedern der Ballroom Szene ein familiäres Netzwerk außerhalb ihrer biologischen Ursprungsfamilie, zu der sie oftmals aufgrund ihrer Queerness kein oder ein schlechtes Verhältnis haben (Vgl. Pearlman 2014, 545). Die ‚Mütter‘ oder ‚Väter‘ dieser Houses sind zumeist respektierte, mehrfache Gewinner*innen von Bällen und gleichzeitig Namensgeber*innen ihrer Häuser, wobei ebenfalls große Designerlabels oder symbolträchtige Begriffe als Bezeichnungen fungieren (Vgl. Bailey 2011, 367). Auch wenn diese Houses in den meisten Fällen nicht mit einem physischen Zuhause gleichzusetzen sind, bieten sie ihren ‚Kindern‘ dennoch eine familiäre Struktur, eine Anlaufstelle und ein Hilfsnetzwerk (Vgl. ebd.). Neben der sozialen Struktur kommt den Häusern die Aufgabe zuteil, Bälle und Wettbewerbe zu organisieren und an ihnen teilzunehmen (Vgl. ebd., 368). Es ist Aufgabe der ‚Hauseltern‘, ihre Zöglinge heranzuziehen und auf die Wettbewerbe vorzubereiten, sodass sie erfolgreich für ihr House antreten können (Vgl. ebd.; Beemyn 2014, 514f.). 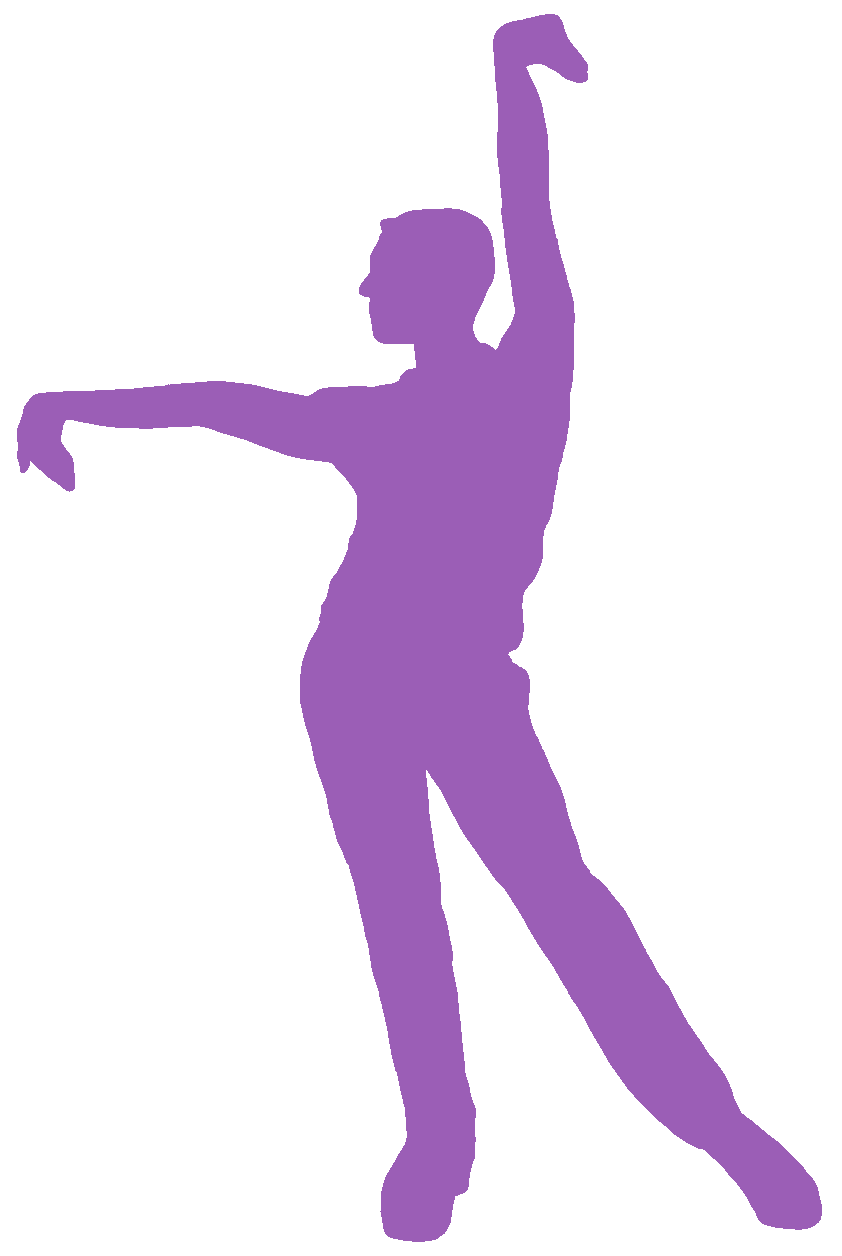
Voguing
Die Urform des ‚Voguing‘ stammt aus dem 19. Jahrhundert und ist nunmehr fester Bestandteil der Wettbewerbe der Ballroom Culture (Vgl. Pearlman 2014, 545). Als Voguing wird ein Tanzstil verstanden, der sich der glamourösen Posen der Modemagazine – insbesondere und daher namensgebend aus der Vogue – bedient (Vgl. Haider 2018). Innerhalb der Ballroom Culture wird Voguing als eine raffinierte Art des Straßenkampfes verstanden, bei der die Person mit der besten Choreografie gewinnt (Vgl. Paris Is Burning 1990, [35:55-37:07]). Generell wird unter drei Subkategorien des Voguings unterschieden:
- Old Way: bezeichnet die Ursprungsform, die durch „kantige Bewegungen“ erkenntlich ist.
- New Way: bezieht „akrobatische Formen“ mit ein.
- Vogue Femme: stellt eine „fast hysterische Weiblichkeit“ dar. (Aha 2016)
In der breiten Masse wurde Voguing durch Madonnas weltbekanntes Musikvideo bekannt, für das sie speziell Tänzer*innen der Ballroom Szene gecastet hatte (Vgl. ebd.).
Die deutsche Ballroom Culture
Insbesondere durch o.g. Erzeugnisse der Popkultur erlangte die Ballroom Culture einen größeren Bekanntheitsgrad. Auch aktuelle Produktionen wie RuPaul’s Drag Race (World of Wonder, Start 2009) oder Pose (FX Productions, Start 2018) sowie die sozialen Medien unterstützen die Verbreitung der subkulturellen Bewegung, wodurch sie international adaptiert wird (Vgl. Haider 2018). 2011 gründete Georgina Leo Melody das erste deutsche House in Düsseldorf (‚House of Melody‘) und rief 2012 in Berlin das ‚Voguing Out Festival‘ ins Leben, das den US-amerikanischen Balls ähnelt (Vgl. Wiedemann 2019). Im Gegensatz zum US-amerikanischen Vorbild ist die deutsche Ballroom Szene nicht exklusiv der queeren Community vorbehalten, sondern auch für Cis-Personen zugänglich (Vgl. Aha 2016).
*Der Madison Square Garden ist eine berühmte Mehrzweckarena in New York City. Sie liegt im Stadtteil Manhattan und wurde 1968 eröffnet. Der Garden, wie er oft genannt wird, beherbergt Sportveranstaltungen, Konzerte, Shows und andere Events. Er ist die Heimspielstätte der New York Knicks (NBA) und der New York Rangers (NHL). Mit seiner architektonisch markanten Form und einer Sitzplatzkapazität von bis zu 20.000 Zuschauern ist der Madison Square Garden ein Wahrzeichen der Stadt und eine der beliebtesten Veranstaltungsorte für Unterhaltung in den USA.
Hier geht es zum Überblick aller Lexikonartikel…
Literatur
Aha, L. (2016): Ballroom Culture im Berliner HAU. She’s a pretty boy. https://taz.de/BallroomCulture-im-Berliner-HAU/!5354047/ [02.09.2020].
Bailey, M. (2011): Gender/Racial Realness: Theorizing the Gender System in Ballroom Culture. In: Feminist Studies 37(2), 365-386.
Beemyn, G. (2014): US History. In: Erickson-Schroth, Laura (Hg.): Trans Bodies, Trans Selve. A Ressource for the Transgender Community. Oxford, New York: Oxford University Press, 501-536.
Haider, A. (2018): How Drag Balls Went Mainstream. https://www.bbc.com/culture/article/20180810-drag-balls-the-glamorous-performances-thatmean-resistance [02.09.2020].
Livingston, J. (Dir.) (1990): Paris Is Burning. Off-White Productions.
Pearlman, L. et al. (2014): Arts and Culture. Erickson-Schroth, Laura (Hg.): Trans Bodies, Trans Selve. A Ressource for the Transgender Community. Oxford, New York: Oxford University Press, 537-566.
Weems, M. (2008): The Fierce Tribe. Masculine Identity and Performance in the Circuit. Utah State: University Press.
https://www.vfmk.org/books/whos-afraid-of-stardust
Ballroom Culture: Alle Infos über die Bewegung | FOCUS.de
Transkript zum Erklärfilm
Ballroom Culture ist eine Bewegung der amerikanischen queeren Szene, die aus der Abgrenzung zur Mehrheitsgesellschaft entstanden ist. Sie umfasst Bälle, bei denen queere Menschen unterschiedlicher kultureller Herkunft zusammenkommen und gemeinsam Wettbewerbe veranstalten. In diesen Wettbewerben laufen einzelne Mitglieder der Szene einen Laufsteg entlang und bieten dabei eine Performance, um die Jury von sich zu überzeugen. Die Ballroom-Wettbewerbe sind auch politisch-kulturell bedeutsam, da sie Geschlechterrollen als Konstrukt entlarfen und Queerness zelebrieren. Die Mitglieder der Ballroom Szene schaffen sich außerdem ein familiäres Netzwerk, in welchem sie Unterstützung finden.
Eine wahre interkulturelle Begebenheit wird in dem Buch von Benjamin Haag geschildert:
Hochziehen oder rotzen
Als ich vor einigen Jahren für ein paar Monate zu Besuch bei meiner Tante in São Paulo war, besuchten wir gemeinsam das japanische Viertel Liberdade. Wir wollten dort einige Freunde meiner Tante treffen, die aus Japan stammen und nun in Brasilien wohnen.
Aufgrund der hohen Abgasbelastung in der Luft der brasilianischen Megacity hatte ich einen gewissen nasalen Schleimfluss und musste mir oft die Nase putzen. Ich tat dies mithilfe herkömmlicher Papiertaschentücher.
Als wir die kleine Gruppe Freunde trafen, begrüßten alle meine Tante sehr herzlich. Küsse und Umarmungen wurden ausgetauscht, auch Hände wurden geschüttelt. Ich hingegen wurde zwar von jedem äußerst freundlich angelächelt und auch, soweit ich das beurteilen konnte, mit freundlichen Worten begrüßt, aber niemand gab mir die Hand, obwohl ich sie jedem zum Handschlag entgegenstreckte. Es schaute auch niemand meine Hand an. Dies wunderte mich stark, denn auch meiner Tante war die Hand gegeben worden. Deshalb dachte ich, meine Geste sei einfach übersehen worden. Etwa eine Stunde zogen wir daraufhin zusammen durch das Viertel und meine Tante übersetzte fleißig, was mir ihre Freunde über die Geschichte von Liberdade erzählten. Als wir uns verabschiedeten, versuchte ich es noch einmal mit der Händeschüttelei, aber wieder regierte niemand auf meine Geste. Ich fragte nicht nach.
Erst als meine Tante und ich auf dem Heimweg waren, fragte ich sie, was es mit der Sache auf sich hatte. Meine Tante lachte und erklärte mir dann, dass es bei Japanern (oder zumindest bei Teilen der in Liberdade lebenden Japanern) nicht üblich sei, Papiertaschentücher zu benutzen und dass dies als unhygienisch und eklig gelte. „Entweder hochziehen oder direkt in den Pulloverkragen rotzen“, bemerkte meine Tante trocken. Auch, dass mich niemand darauf hingewiesen hatte, überraschte meine Tante nicht.
